


| Impressum | Links | |
 |
||
 |
 |
|
Entstehungsgeschichte und Kritik der
|
|
Litteratur. Das Beste, was wir darüber besitzen, ist zweifelsohne auch heute noch die Schmoller’sche Abhandlung: „Das Merkantil - System in seiner historischen Bedeutung“, zuerst 1884, jetzt in „Umrisse und Untersuchungen zur Verfassungs- Verwaltungs- und Wirtschaftsgeschichte“ 1898 separat erschienen. Vergleiche ferner Schönberg, Handbuch der politischen Oekonomie, Band 1, Seite 88 ff., 4. Auflage, 1896. Adolf Wagner, Finanz - Wissenschaft, Band I, Seite 30 ff., 3. Auflage, 1883. J. Conrad’s Handwörterbuch der Staatswissenschaften, Artikel Merkantil - System, ferner Conrad, Leitfaden, 1. Teil, 3. Auflage. Wilhelm Roscher: Versuch einer Theorie der Finanz-Regalien, 1884. Von den historischen Spezialwerken sind hier insbesondere zu beachten: Ehrenberg, „Das Zeitalter der Fugger“, 1. und 2. Band, 1896; Max Jähns, „Heeresverfassung und Völkerleben“, 1885 und A. Gottlob, „Die päpstlichen Kreuzzugssteuern des 13. Jahrhunderts“, 1892. Vergleiche ferner die Geschichte der nationalökonomischen Theorien: Böhm-Bawerk, Kapital und Kapitalzins, 2 Bände, 1884 und 1889. Aug. Oncken-Bern, Was sagt die Nationalökonomie als Wissenschaft über die Bedeutung hoher und niedriger Getreidepreise, 1901, und Aug. Oncken-Bern, Die Geschichte der politischen Oekonomie, Band 1; Die Periode vor Adam Smith, 1902.
Antonio Serra, breve trattato della cause, che possono far abondare gli regni d’oro e d’argento, dove non sono miniere, Napoli 1613. Antonio Broggia, trattati dei tributi e delle monete, 1743. Antonio Genovesi, Lezioni di Commerzio e di Economia civile, 1760. Deutsch: Leipzig 1776. Thomas Mun, a discourse of trade from England into the East Indies 1609, 2. Aufl, 1621. Dann: Englands treasure by foreign trade or the balance of our foreign trade is the rule of our treasure, 1664. Josiah Child, Observations concerning trade and interest of Money, 1868 und: A new discourse of trade, 1690. William Temple, Considerations sur le Commerce et l’argent, 1672. François Mélon, Essais polit. sur le commerce, 1731; deutsch: Jena 1740. In Deutschland sind zu nennen: Kaspar Klock, Tractatus economico - politicus de contributionibus 1632 II de aerario. Veit. Ludw. von Seckendorff, Der teutsche Fürstenstaat, 1655, zuletzt 1754. Johann Joachim Becher, Politischer Discurs von den eigentlichen Ursachen des Auf- und Abnehmens der Städte, Länder etc., 1668. W. von Schröder, Fürstliche Schatz- und Rentkammer, 1686. Die merkantilistische Praxis finden wir im 17. und 18. Jahrhundert, ohne Einseitigkeit besonders unter Colbert (1619 bis 87), sehr ausgeprägt unter Cromwell, aber auch bei Friedrich Wilhelm I., Friedrich dem Grossen und anderen Fürsten.
* * *
Innerhalb der Grenzen des mächtigen
Kaiserreiches, wie es Karl der Grosse geschaffen hatte,
kam bekanntlich zunächst die lehensstaatliche
Verfassung zur Blüte und der Idee nach zur
Herrschaft. Das alles war ein gewaltiger Fortschritt in
der Organisation der Völker auf der Basis des
Grundbesitzes. In den Städten und an den Sitzen der
grossen Herren entwickelte sich indess bald jener Keim,
der mit seiner weiteren Ausbreitung schliesslich den
ganzen Lehensstaat als herrschende
Verfassung vernichten sollte, um das Volk nach einer
Uebergangszeit recht bedenklicher Die Ersten, welche in der germanischen Geschichte diese Grundsätze zur praktischen Anwendung brachten, waren die mittelalterlichen Städte. In dem Masse, als dann die selbständigen Monarchien neben dem Deutschen Kaiser sich ausbildeten, mussten auch diese in der gleichen Weise handeln. Mit der Ausbreitung der Geldwirtschaft hatte sich auch
die lehensstaatliche Heeresverfassung rasch
als nicht mehr zeitgemäss erwiesen. An ihre Stelle
traten die Söldner, die zu Anfang
namentlich durchaus in den Formen einer Kapitalsanlage in
der Hand der Kriegsspekulanten auftraten. Der Soldat war,
wie man schon gegen Ende des fünfzehnten
Jahrhunderts in der Schweiz So waren die Zeitverhältnisse, unter denen allein
der dreissigjährige Krieg möglich war. Nach
seinem Ende waren die Völker so sehr verarmt, dass
die Widerstände gegen den Ausbau der territorialen
Gewalt geschwunden und die Entwickelung des
modernen Staates beginnen konnte; zunächst in
der Form des Absolutismus. Dass es in der
bis dahin üblichen „wilden“ Wirtschaft
bei dem „Regieren“ nicht weiter gehen konnte,
musste jedem Denkenden klar sein. Und indem man nun
anfing, eine wirtschaftliche Ordnung zu schaffen, und
darüber nachdachte, wie diese Ordnung am besten
gestaltet sein könnte, entstand jene Litteratur, die
wir als die des Merkantilismus bezeichnen.
Unzweifelhaft aber wird man es als einen Beweis des
Fortschritts in der Gesittung unter der Herrschaft des
aufgeklärten Absolutismus bezeichnen müssen,
wenn die Fälle der Soldatenvermietungen gegen Ende
des siebenzehnten Jahrhunderts und später, wie von
Fürst Bernhard von Galen, Bischof von
Münster, Kurfürst Johann Georg
III. von Sachsen, von den Fürsten und Herren
von Hessen- Eine Politik, deren Aufgabe es war, den absoluten
Fürsten möglichst gross und mächtig zu
machen, was unter den gegebenen Verhältnissen mit
„reich“ zusammenfiel, musste offenbar nicht
nur den Reichtum in Geld, sondern auch den in Grundbesitz
erstreben. Daraus folgt der Grundsatz: den
Dominialbesitz nicht nur zu erhalten,
sondern auch thunlichst zu mehren. Was vorher darin zur
Zeit der „wilden“ Wirtschaft vielfach
verschleudert worden war, musste so viel als möglich
zurückerworben werden. Hierzu eignete sich
namentlich die Auflösung der noch vorhandenen
deutsch-rechtlichen Ober- und Unter-
Eigentumsverhältnisse nach den
römisch-rechtlichen Begriffen. Die Bedeutung eines
grossen Domänenbesitzes lag nicht nur in dem
sicheren Einkommen, welches derselbe gewährt,
sondern auch in dessen Eigenschaft, nötigen Falls
als Pfandobjekt für grössere Gelddarlehne zu
dienen. Mit diesem Dominialbesitz in engster Verbindung
steht die merkantilitische
Getreidepreispolitik. Wo, wie in
Preussen, das Einkommen aus den Domänen
einen wesentlichen Teil des Staatseinkommens ausmachte,
musste eine weise Regierung bestrebt sein, durch eine
zielbewusste Magazinpolitik in Verbindung mit einem ganz
bestimmten System von Einfuhrverboten, Einfuhrzöllen
und eventuellen Ausfuhrvergünstigungen die
Getreidepreise möglichst stetig auf mittlerer
Höhe zu erhalten. Das ist bekanntlich am
vollkommensten einem Friedrich dem Grossen
gelungen. Wo, wie in Frankreich, das
Staatseinkommen hauptsächlich auf Gewerbe und
Industrie beruhte, und dem gegenüber das Einkommen
aus den Eine andere naheliegende Quelle zur Mehrung des
fürstlichen Geldeinkommens bot abermals das
römische Recht in der Ausbildung der
Regalien. Hier gab es das Zollregal auf
Strömen, Flüssen und Strassen. Es gab das
fürstliche Heimfallrecht an dem Vermögen der
ausgestorbenen Familien, das bei den verheerenden
Volksseuchen während und nach dem
30 jährigen Krieg gewiss nicht unergiebig war.
Es gab das Recht auf die gestrandeten Güter, das
Jagd- und Fischerei-Regal und die Kriegshoheit mit dem
Rechte, heimische Truppen an fremde Mächte zum
Kriegführen zu vermieten. Es gab das
Gebührenwesen verschiedenster Art für einzelne
obrigkeitliche Handlungen. Es gab den Verkauf von
Privilegien, Titeln und Aemtern aller Art. Es gab die
Gerichtshoheit mit Geld- und Vermögensstrafen bis
zur vollen Vermögenskonfiskation, welche namentlich
bei grossen politischen Bewegungen umfassend In engster Verbindung mit dieser Regalienpolitik stand
dann wieder die Begünstigung des Handels mit
den Produkten der exportierenden Gewerbe. Wo ein
exportierendes Gewerbe noch nicht vorhanden war, musste
ein solches durch Mithilfe des Staates geschaffen werden.
Fremde Unternehmer und Arbeiter wurden gerufen und vor
allem mit dem Privilegium der Steuerfreiheit
ausgestattet. Der Export dieser Produkte nach fremden
Märkten oder Ländern war zollfrei oder sogar
durch Exportprämien unterstützt, während
ihnen auf dem inländischen Markte durch das
Einfuhrverbot für gewerbliche Produkte das Monopol
reserviert wurde. Um die Produktionskosten thunlichst zu
verringern, wurde den inländischen
Rohprodukten die Ausfuhr verboten, die Einfuhr von
Rohprodukten aber freigegeben oder eventuell durch
Importprämien begünstigt. Dazu kamen
Preis- und Lohntaxen und eine
Bevölkerungspolitik, welche auf eine thunlichste
Mehrung der Bevölkerungszahl abzielte. Damit aber
auch der Exportgewinn ganz im eigenen Lande bliebe, wurde
der Export durch inländische Kaufleute mit Hilfe der
heimischen Handelsflotte bevorzugt. So wurde
der Handel mit dem Auslande nach dem Grundsatze
organisiert: Export von veredelten gewerblichen Produkten
und Import von zu Es steht also in der merkantilistischen Politik neben dem Prinzip der Ansammlung eines möglichst grossen Reichtums, und zwar vor allem des Geldreichtums, die Begünstigung der Exportindustrie, des auswärtigen Handels, der heimischen Handelsflotte und die Notwendigkeit einer möglichsten Ausdehnung der Kriegsflotte. Vom Standpunkte der Entwickelungsgeschichte der Völker betrachtet, charakterisiert sich das Merkantilsystem als das durchaus notwendige Uebergangsstadium aus der stadtwirtschaftlichen in die volkswirtschaftliche Epoche (Schmoller und Bücher). Dass hier der Absolutismus mit Hilfe des Geldes seine Aufgabe im allgemeinen in durchaus befriedigender Weise gelöst hat, bezeugt am besten die Thatsache, dass unsere moderne Kultur durchweg auf dem Fundamente ruht, das der Absolutismus damals gelegt hat. Wenn aber in jener Periode namentlich der Bauer mit der Arbeiterbevölkerung besonders zu leiden hatte, so mögen heute beide nicht vergessen, dass die wirtschaftlichen wie politischen Freiheiten, deren sie sich erfreuen, nicht zuletzt dem gleichen theoretischen Grundgedanken entsprungen sind. Wir dürfen deshalb im allgemeinen unter den gleichen wirtschaftlichen Voraussetzungen auch wieder das gleiche wirtschaftlich-politische System erwarten. Trotzdem seit Anfang des neunzehnten Jahrhunderts in
allen mitteleuropäischen Kulturländern
namentlich das Merkantilsystem alten Stils durch eine
neue und unzweifelhaft bessere volkswirtschaftliche
Ordnung auf dem Prinzip der Freiheit der Arbeit und der
Selbstverantwortlichkeit des Einzelnen ersetzt worden
ist, gefällt sich die Wirtschaftspolitik unserer
Tage doch wieder in überraschenden Anklängen an
das alte Merkantilsystem. Unter der Leitung des Geldes
(Grossbanken) beobachten wir eine kapitalistisch –
industrielle Entwickelung der Völker auf Kosten der
Landwirtschaft und des Mittelstandes. Der Exporthandel
gewinnt abermals eine ganz besondere Bedeutung. Die
Entwickelung und Ausdehnung der Handelsflotten wird
thunlichst gefördert. Die Ausbreitung des
Kolonialbesitzes führt zu den charakteristischen
Kolonialkriegen, und die bei dieser Entwickelung einander
widerstreitenden Interessen werden nur zu häufig
Trotzdem umfasst auch das Merkantilsystem mit seinen Anschauungen eine Reihe von Sätzen, die uns von Dauer zu sein scheinen, und als solche möchten wir bezeichnen: 1. Jede Volkswirtschaft braucht auf einer gewissen Höhe ihrer Entwickelung neben der Urproduktion und ihren Produkten Geld, Gewerbe und Industrie als gleichbedeutende und gleichberechtigte Faktoren. 2. Das Blühen und Gedeihen eines Landes in volkswirtschaftlicher Hinsicht wie auch der Arbeitserfolg eines jeden Einzelnen ist dann im wesentlichen abhängig von einer richtigen Wirtschaftspolitik des Staates. 3. Alle Massnahmen des Staates finden einen höchst beachtenswerten und höchst bedeutungsvollen Massstab ihrer Zweckmässigkeit an dem Abschluss der jährlichen Handelsbilanz. Ein Volk, das dauernd mehr ausgiebt, als es einnimmt, wird ebenso sicher zu Grunde gehen, wie das im gleichen Falle bei jeder Einzelwirtschaft nicht anders zu erwarten ist. Ein Streit kann nur darüber noch geführt werden, ob dieser Nachweis statistisch in zutreffender oder unzutreffender Weise geführt wurde. Vorbemerkungen und Litteratur: Der eigentliche Inhalt des physiokratischen Systems ist uns erst neuerdings durch die ausgezeichneten Arbeiten von Professor August Oncken-Bern erschlossen worden. Vergleiche dessen „Oeuvres Economiques et Philosophiques de François Quesnay“, Frankfurt und Paris 1880. Derselbe: „Entstehen und Werden der physiokratischen Ideen“, „Biographie des Stifters der Physiokratie“, „Ludwig XVI. und das physiokratische System“ als Abhandlung in der „Vierteljahrsschrift für Staats- und Volkswirtschaft“ von Kuno Frankenstein 1898/9. Derselbe: Artikel „François Quesnay“ und „Das physiokratische System“ im Handwörterbuch der Staatswissenschaften von Conrad. François Quesnay war am 4. Juni
1694 in dem Dorfe Méré bei Versailles
geboren. Seine Entwicklung ist eine durchaus
autodidaktische. Von einem Gärtner hat er Lesen
gelernt, ist dann bei einem Wundarzt als Lehrling
davongelaufen, in Paris Lithograph geworden, hat als
solcher durch Selbststudium medizinische und
philosophische Kenntnisse sich angeeignet, wird im Alter
von 24 Jahren (1718) staatlich geprüfter Wundarzt,
1735 Leibchirurg des Herzogs von Villeroy und
veröffentlicht als solcher mehrere bedeutende Werke
über Chirurgie. Ein Gichtleiden hindert ihn am
Operieren. Er wendet sich deshalb dem Studium der inneren
Medizin zu, erwirbt 1744 im Alter von 50 Jahren den
medizinischen Doktorgrad und wird damit praktischer Arzt.
1749 ist er Leibarzt der Pompadour und kommt deshalb nach
Versailles, 1752 königlicher Leibarzt, nachdem er
den Dauphin von den Blattern geheilt. Jetzt erst
beginnen im Anschluss an psychophysiologische Studien die
ökonomischen Studien Quesnay’s, deren
erste im Jahre 1756/7 (im Alter von 62 Jahren !) in der
„Encyclopädie“ von
d’Alembert erschienen sind und zwar
gezeichnet mit dem Namen seines Sohnes, der Landwirt war.
Ende 1758 vollendete er das „Tableau
économique“, den „Trésor
de la science économique“, wie seine
Schüler es nannten. Darüber hinaus hat die
physiokratische Lehre keine Entwicklung erfahren. Quesnay
wendet sich dann im Alter von 75 Jahren mathematischen
Studien zu und stirbt am 16. Dezember 1774 im Alter von
80 Jahren. Quesnays erster Schüler war der
Marquis Victor de Mirabeau. Weiter werden
als solche genannt: Dupont de Nemours,
Gournay Ueber die Zeitverhältnisse vergleiche insbesondere: H. Taine, „Die Entstehung des modernen Frankreichs“, deutsch von Katscher (1877), ferner Thiers „L’histoire de la révolution française“ (6 Bände, 15. Auflage, 1881), von Sybel „Geschichte der Revolutionszeit“ (5 Bände, 1882).
* * *
Das französische Königtum hat den französischen Staat geschaffen: äusserlich zusammengefügt und innerlich verschmolzen zu einer grossen volkswirtschaftlichen Gemeinschaft, die alle Aussicht auf glückliche Verhältnisse für ihre Mitglieder zu haben schien. Die Herrschaft der Engländer in Frankreich (1346—1453), welcher das Land schon fast hoffnungslos erlegen war, haben die französischen Könige durch Organisation und Einrichtung des ersten modernen stehenden Heeres (1439) beseitigt. Die damit Hand in Hand gehende Ausbildung eines Geldsteuersystems (Jacques Coeur) lieferte die hierzu unentbehrlichen Geldmittel. Die grössere Konzentration des Einkommens in der Hofhaltung förderte Kunst und Gewerbe ganz ausserordentlich. Damit wuchs auch das Ansehen und die Bedeutung des französischen Handels, der durch eine sehr energische Kolonialpolitik in nachhaltigster Weise unterstützt und begünstigt wurde. In eben dieser Allmacht des französischen
Königs lag indess auch der Keim zum Verderben,
zunächst für das Wohl des französischen
Volkes, und schliesslich für das Königtum
selbst. Ludwig XIV. (1643—1715) hatte
durch ein berüchtigtes Werbesystem seine
königliche Armee von 180'000 Mann im Jahre 1672
rasch auf 400'000 Mann anwachsen lassen. Zeitweilig
wurden z. B. alle Bauten All diese schweren Missstände, die unter der
Regierung Ludwigs XIV. schon deutlich genug begonnen
hatten, dauern unter den beiden folgenden Königen an
und wandelten alle früheren Segnungen des
Königtums rasch in wachsendes Unheil. Das Princip,
das Kalb im Leibe der Kuh aufzuessen und das laufende
Jahr stets im voraus die Früchte des folgenden
aufzehren zu lassen, wurde beibehalten. Dem
Staatsbankrott unter Ludwig XIV. folgte ein zweiter in
der gleichen Höhe zur Zeit des berüchtigten
Börsen- und Aktienschwindlers Law
(1671—1729), ein dritter unter
Terray, denen sich bis zur grossen
Revolution noch zwei weitere tief einschneidende
Staatsbankrotte anschliessen. Seit Heinrich IV. bis auf
das Ministerium Loménie sind die
öffentlichen Verbindlichkeiten 56 Mal nicht
eingehalten worden. Schon um die Mitte des achtzehnten
Jahrhunderts war der Staat unfähig, seinen
ausgedehnten Kolonialbesitz zu halten. Die stattliche
Kriegsflotte wurde aufgerieben. Die Zinsen der
Staatsschulden betrugen 1755: 45 Millionen Francs, 1776:
106 Millionen Francs, 1789: 206 Millionen Das Bürgertum hat bei diesen Veränderungen unzweifelhaft viel Geld zu gewinnen verstanden. Es war selbstverständlich, dass dem König nicht unter 10% geliehen wurde. Dazu kamen die grossen Schuldaufnahmen des Adels, das allgemein eingeführte Steuer-Pachtwesen mit seinen Tausenden von Gelegenheiten, sich zu bereichern, die eigentümliche Einrichtung der Intendanten, die als die „32 Könige von Frankreich“ bezeichnet wurden u.s.w. Das Luxusgewerbe und der Export industrieller Erzeugnisse blühten. Bordeaux war damals nach London der bedeutendste Handelshafen Europas. Die Ausfuhr Frankreichs betrug in den Jahren 1720: 106 Millionen Francs, 1748: 192 Millionen Francs, 1788: 354 Millionen Francs. Frankreich versorgte die ganze Welt mit künstlerischen und kunstgewerblichen Erzeugnissen. Aber trotz dieser ganz unzweifelhaften Zunahme des
Wohlstandes in Bürgerkreisen war man auch hier mit
den bestehenden Verhältnissen recht unzufrieden. Die
häufigen Staatsbankrotte hatten auch die Bürger
misstrauisch gemacht. Man hätte gern die Verwendung
seiner, dem König geliehenen Gelder überwacht.
Denn mit dem Staatsbankrott drohte auch den
Staatsgläubigern Unheil. Aber statt dieser
Ueberwachung der Verwendung der Staatsgelder war dem
Bürgertum von damals nicht einmal seine
Selbstverwaltung gesichert. Seit dem Jahre 1692 hatten
die Städte sieben Mal eine Art Selbstverwaltung
erhalten, die immer wieder aufgehoben wurde, um sie dann
von der Krone für teures Geld wieder
zurückkaufen zu lassen. Dazu kam der in der sonst so
liebenswürdigen Gesellschaft Der Adel ging durch seine Teilnahme an dem so überaus luxuriösen Hofleben des Königs nur zu rasch der Verarmung entgegen und ward durch die gegebenen Verhältnisse geradezu gezwungen, seine übermässigen Ausgaben auf den von ihm abhängigen Bauernstand abzuwälzen. Die Masse der Geistlichkeit war arm geblieben, und wenn sie auch formell das Privileg der Steuerfreiheit besass, so wandte sich doch von Zeit zu Zeit der König um Geldgeschenke an den Klerus, wobei dann selbst die armen Landgeistlichen mitsteuern mussten. Am schlechtesten von allen erging es dem
Bauernstand. Die Beziehungen zwischen ihm
und dem Adel konnten um so leichter eine höchst
drückende Form annehmen, als die Mehrzahl der
Adligen durch dauernde Anwesenheit bei Hofe mit ihren
bäuerlichen Pächtern garnicht direkt, sondern
stets durch Vermittelung ihrer Beamten verkehrten. Durch
die Verbindung der längst veralteten, aber immer
noch zu Recht bestehenden Feudalleistungen mit dem
indirekten Steuersystem des Merkantilismus kam eine fast
unübersehbare Zahl von Forderungstiteln zusammen,
welche ebenso viel Handhaben zu ungerechten
Bedrückungen der Bauern boten. So gab es z. B. neben
der allgemeinen direkten persönlichen Staatssteuer
den kirchlichen Zehnt, Frohndienste, Zölle aller
Art, hohe Handänderungs-Gebühren für den
Grundbesitz, herrschaftliche Kelter- und
Mühlenmonopole, das herrschaftliche Jagdrecht,
herrschaftliche Taubenschläge, Wegebauten für
alle mög Die Verarmung der bäuerlichen Bevölkerung
nahm unter solchen Umständen furchtbare Dimensionen
an. Etwa seit dem Jahre 1672 war die Hungersnot auf dem
Lande fast permanent geworden. Vauban sagt
1699 in seiner „Dîme royale“:
„Fast der zehnte Teil des Volkes bettelt. Von den
anderen neun Zehnteln können fünf den Bettlern
kein Almosen geben, denn sie bedürften dessen
eigentlich selbst. Drei Zehntel sind auch noch
überaus schlecht daran, und das letzte Zehntel
umfasst etwa 100'000 Familien, von denen vielleicht
10'000 "à leur aise" leben. “ — Im
Jahre 1715 sollen 6 Millionen Franzosen den Hungertod
gestorben sein. Im Jahre 1725 lebte ein Drittel der
Landbevölkerung der so fruchtbaren Normandie von
Feldkräutern. In hundert Jahren soll die
Bevölkerung Frankreichs von 23 auf 12 Millionen
zurückgegangen sein. Die procentuale Abnahme der
ländlichen Bevölkerung war natürlich eine
noch weit stärkere. Was nicht überhaupt
auswanderte, das zog in die Städte und namentlich
nach Paris, um die Man wird es unter solchen Umständen begreiflich finden, wenn Taine die grosse französische Revolution die „siebente Jacquerie“ (französischer Bauernkrieg) nannte, die allgemein und endgültig war. Nur in der Vendée hatten sich bessere Beziehungen zwischen Adel und Bauern erhalten, und deshalb wurde hier eine echt konservative Gesinnung für den König noch über die Revolutionsjahre hinaus bewahrt. Das nationalökonomische System, welches solche
Zeitverhältnisse zum Ausgangspunkt hatte, war vor
dem Irrtum sicher, im Gelde und in einer blühenden
Exportindustrie die Elemente des Glücks und der
Wohlfahrt der Völker zu erblicken. Jetzt ging man
vielmehr von der grundlegenden Frage aus:
„Wie muss die wirtschaftspolitische Ordnung
eines Landes beschaffen sein, um ein Volk auf gutem
Boden, unter günstigen klimatischen
Verhältnissen vor Not zu bewahren ?“
Und die Antwort von François Quesnay
kam naturgemäss vor allem zu der fundamentalen
Bedeutung des gerade damals so sehr verachteten und
bedrückten Bauernstandes. Denn — so sagte
Quesnay — „die Wohlhabenheit, der Reichtum
eines Volkes, setzt sich zusammen aus der Summe jener
materiellen Güter, welche in der einen oder anderen
Form dem Boden entnommen sind.“ Jede Vermehrung der
Güter hat deshalb ein vermehrtes Schöpfen von
Stoffen aus dem Boden zur Voraussetzung. Und nachdem
diese Stoffe vom Boden losgelöst sind, kann im
weiteren die menschliche Arbeit dieselben zwar veredeln
Die wichtigste Urproduktion ist die
landwirtschaftliche Produktion und zwar speziell die
Getreideproduktion. Im Mittelpunkte aller
wirtschaftspolitischen Erwägungen steht deshalb die
Frage nach der richtigen
Getreidepreispolitik. Die Getreidepreise
sollen nicht zu hoch sein, damit das Volk nicht Not
leiden muss. Sie sollen aber auch nicht zu niedrig sein,
um den Bauer nicht vom Acker zu verjagen und die
Landbevölkerung im Elend verderben zu lassen. Es
handelt sich also um mittlere
Getreidepreise, bei denen Bauer und Bürger bestehen
können. Diese guten, mittleren Getreidepreise sollen
nicht vorübergehend, sondern von Dauer sein. Und
wenn diese dauernd guten Getreidepreise den Pächter
wohlhabend machen, dann kann er sein Betriebskapital
vermehren, den Betrieb intensiver gestalten und damit das
Volk immer besser vor Not sichern. Er kann dem
Grundeigentümer höhere Pachtrenten zahlen,
womit die Kaufkraft der ländlichen Bevölkerung
für industrielle Produkte allgemein wächst. Und
da mit der Höhe der Getreidepreise auch die
Arbeitslöhne direkt proportional steigen und fallen,
so hat auch der Lohnarbeiter aus einer Besserung der
Getreidepreise zunächst keinen Nachteil, wohl aber
durch die wachsende landwirtschaftliche Wohlhabenheit den
Vorteil gesteigerter Arbeitsgelegenheit. Sind umgekehrt
die Dieses Hauptziel: dauernd gute, mittlere Getreidepreise, wäre nach Quesnay zu seiner Zeit zu erreichen gewesen durch freie Getreideausfuhr mit Ausfuhrprämie bei niedrigen inländischen Getreidepreisen, durch Getreideeinfuhrverbot, ausgenommen in Teurungsjahren, und durch Verbesserung der inländischen Verkehrswege. Damit aber der Bauer in freudiger Arbeit sich und der Gesamtheit die reichen Vorteile aus den besseren Getreidepreisen erwerbe, verlangt François Quesnay gleichzeitig: Beseitigung der damals allgemein üblichen Zwerg- und Teilpachtungen durch ebenso allgemeine Einführung grösserer Pachtgüter, vollständige Abschaffung aller Feudallasten und feudalen Unfreiheiten jeder Art, Aufhebung des Flurzwanges, Befreiung vom Milizdienst und last but not least: Aufhebung aller direkten und indirekten Steuern des Merkantilismus und Deckung des Staatsbedarfs durch eine einzige Staatssteuer, welche auf den Reinertrag des Bodens gelegt wird. Auch dieser steuerpolitische Vorschlag Quesnay’s
steht in engstem Zusammenhange mit seiner Auffassung des
Bodens als ausschliessliche Quelle des Reichtums und hat
naturgemäss die allgemeine Einrichtung grosser
Pachtgüter und dauernd gute, mittlere Getreidepreise
zur Voraus Die Grundherren haben den Boden in Kultur gebracht, Häuser gebaut und andere Meliorationen aller Art ausgeführt. Sie behalten auch ferner die Oberleitung des Betriebes. Dafür beziehen sie die Pachtrente, welche Quesnay „Produit net“, also Reinertrag, nennt. Dieser Reinertrag setzt sich nach ihm zusammen aus dem Ertrage der natürlichen Fruchtbarkeit des Bodens plus Zinsen für die ausgeführten Meliorationen. Der Wert der natürlichen Fruchtbarkeit des Bodens deckt sich allem Anschein nach mit dem ursprünglichen Ertragswert des Bodens, der nach seiner einmaligen Ermittelung unverändert bleibe. Veränderlich ist in dem Quesnay’schen Grundwertbegriff das Meliorationskapital und die Höhe des Zinsfusses, zu welchem dasselbe dem Grundherrn von Seiten des Pächters verzinst werden muss. Dieser Zinsfuss soll gesetzlich und möglichst hoch — mindestens auf 10% — festgesetzt werden, damit die Grundeigentümer sich zur Ausführung von Meliorationen möglichst angeregt fühlen. In analoger Weise wäre die städtische Mietsrente zu ermitteln, um so die eine Staatssteuer auf dem Boden-Reinertrag gleichmässig durch das ganze Land auslegen zu können, nach Massgabe eines Katasters, dessen Steuern nicht die Steuerpächter, sondern die Provinzen einziehen und an den König abführen würden, der keinen Staatsschatz anlegen, aber auch keine Staatsschulden machen soll. Kommt aber der Staat in Geldnot, dann würden die Grundbesitzer und Landwirte freiwillig aushelfen. Im Gegensatze zu den Urproduzenten, welche dem Boden
die Güter abgewinnen, sind die
Manufakturisten und
Händler zwar nicht direkt unproduktiv,
aber der von ihnen erzeugte Mehrwert wird von den Kosten
der darauf François Quesnay, der seine Laufbahn als
Chirurg begann und schliesslich Leibarzt des Königs
von Frankreich geworden war, hat sich erst im Alter von
etwa 60 Jahren dem Studium der volkswirtschaftlichen
Fragen zugewendet. Dieser Umstand hat ihn zum mindesten
gehindert, eine rege Beziehung und Wechselbeziehung Jahre
hindurch mit dem wirtschaftspolitischen Leben seiner Zeit
zu unterhalten. Es ist dies meines Erachtens von um so grösserer
Bedeutung, als jetzt erst in der
nationalökonomischen Ent Jetzt erst beginnt die Zeit auszureifen für die
Quesnay’sche Erkenntnis, dass das Glück und
die Wohlfahrt der Völker sich
nationalökonomisch nicht in dem Begriff
des Kapitals erschöpft, sondern auf dem
Acker in der Entwickelung der Ideen beginnen
muss. Ich bin deshalb der Meinung, dass gerade das
physiokratische System 1. Der Begriff Reichtum der Völker — in volkswirtschaftlich-absolutem, nicht historisch- relativem Sinne — muss mit jenen Stoffen beginnen, welche der Erde entnommen werden. Und deshalb ist und bleibt die Mutter Erde die alleinige Quelle alles Reichtums. 2. Jede einseitige Herrschaft des Kapitalismus, der kapitalistischen Exportindustrie und des Exporthandels muss nach einer gewissen Zeit zur Verarmung und Verelendung der Volksmassen führen, selbst dann, wenn anfangs die wirtschaftliche Lage des Volkes sich dabei verbessert hat. 3. Der Wohlstand keines Teils der Nationen ist in gleichem Masse mit dem Gesamtwohl des Volkes inniger verwachsen, als der Wohlstand der Bauern und der Landwirte. 4. Für diesen landwirtschaftlichen Wohlstand sind in erster Linie der Staat und die Gesetzgebung verantwortlich, weil beide für eine rationelle Getreidepreis- und Grundwertspolitik verantwortlich sind. 5. Aufgabe einer rationellen Getreidepolitik ist es, dauernd gute und möglichst stetige mittlere Getreidepreise zu erzielen, bei denen Bauer und Bürger bestehen können. 6. Der wahre und natürliche Wert des landwirtschaftlichen Grundbesitzes wird gebildet aus dem ursprünglichen Ertragswert plus Summe des rationell investierten Kapitals.
Adam Smith, Robert Malthus,
David Ricardo
und die eigentliche Freihandelsschule.
Vorbemerkungen und Litteratur: Die Nationalökonomie als „reine“ Wissenschaft mag immerhin die sogenannten „Vorläufer“ von Adam Smith und Andern eingehend berücksichtigen. Die Nationalökonomie als „praktische“ Wissenschaft wird sich stets erinnern müssen, dass es ihre ernste und schwierige Aufgabe ist, den Plan zu zeichnen, nach dem die Gesetzgebung der Gegenwart und der nächsten Zukunft im Interesse einer inneren Wiedergesundung unserer volkswirtschaftlichen Verhältnisse ausgebaut werden muss, ehe es zu spät ist. Die deshalb von uns hier angewendete kairologische Methode lässt im Zweifel jeden für diesen einen grossen praktischen Zweck überflüssigen Wissensstoff bei Seite. Gleichzeitig gehen wir dabei auch von der praktischen Erfahrung aus, dass Männer, welche wirklich nachhaltig auf die volkswirtschaftliche Praxis einwirken, ihre Stärke in der Durchdenkung dieser Zeitverhältnisse, niemals aber im Abschreiben ihrer sogenannten „Vorläufer“ suchen und finden werden. Wir beschäftigen uns hier deshalb speziell nur mit Adam Smith, Robert Malthus und David Ricardo. Von jenen Nationalökonomen, welche das damit in seinen Elementen gegebene Freihandelssystem dann in der Schule und in der Volksversammlung populär gemacht haben, darf es genügen, unten im Zusammenhang der Darstellung die Namen zu nennen. Adam Smith, geboren im Jahre 1723 in dem schottischen Städtchen Kirkcaldy, wird im Jahre 1751 Professor der Logik und Moralphilosophie in Glasgow. Er geht im Februar 1764 mit dem jungen Herzog von Buccleuch, dessen Ausbildung er leitete, nach Frankreich und der Schweiz, lernt in Paris die Philosophen und die Nationalökonomen der Quesnay’schen Schule kennen, kehrt im Jahre 1766 nach Kirkcaldy zurück, wo er 1776, also nach 10 Jahren, sein berühmtes Werk über den Reichtum der Nationen: „An Inquiry into the nature and causes of wealth of nation“ beendet. Er wird darnach Mitglied der obersten Zollbehörde für Schottland in Edinburg und stirbt 1790. Thomas Robert Malthus lebt in
der Zeit von 1766 bis 1834. Nachdem er Geistlicher
geworden war, nimmt er 1797 an der politischen Bewegung
für und gegen die englische
Armenrechtsordnung David Ricardo wird im Jahre 1778 in London als Sohn eines holländischen Juden geboren, sein Vater war strenggläubig. Nach kaum vollendetem vierzehnten Lebensjahre ist der Sohn in das Geschäft des Vaters eingetreten, noch im Jünglingsalter aus Rücksichten auf sein geschäftliches Fortkommen zur anglikanischen Kirche übergetreten und wird deshalb von seinem Vater verstossen. Mittellos, aber mit Fähigkeiten und ausgeprägtem Geschäftssinn ausgestattet, wird er dann Privatmakler in der City of London, macht in der damals unruhigen Zeit Arbitragegeschäfte in Wechseln und Wertpapieren, spekuliert auch mit Erfolg in Getreide und ist bereits mit 25 Jahren mehrfacher Millionär. Jetzt widmet er sich der Wissenschaft und zwar vor Allem der Nationalökonomie, welcher eine ganze Reihe von Gelegenheitsschriften gehören. Sein Hauptwerk, in welchem diese Gelegenheitsschriften mit verwendet werden, erschien zuerst 1817 unter dem Titel: „Principles of political Economy und Taxation“ Er wird 1797 Mitglied des englischen Parlaments und stirbt 1823. Ueber die Zeitverhältnisse vergleiche insbesondere:
* * *
Das Eindringen der Geldwirtschaft zeigt in der englischen Geschichte früh schon die Tendenz, die Masse des Volkes vom Grund und Boden loszulösen, den Bauernstand zu vernichten. Schon unter Eduard III. (1327 bis 77) kommt es zur Trennung des Parlaments in Ober- und Unterhaus, welch letzteres das Steuer - Bewilligungsrecht und das Petitionsrecht erhält: die Vertreter der Geldwirtschaft hatten damit als Mitregenten des Landes ihre selbständige verfassungsrechtliche Organisation erhalten. Sofort beginnt eine zielbewusste merkantilistische Gewerbe-Politik, die sich speziell dem Hauptgewerbe der damaligen Zeit, dem Wollgewerbe, widmet: die Einwanderung fremder Weber wurde begünstigt, das Tragen fremder Tuche verboten, die Wollausfuhr an Privilegien gebunden und damit indirekt in den Händen der Privilegierten monopolisiert, die Entwickelung der eigenen Handelsmarine und des eigenen Aussenhandels thunlichst begünstigt. Zunächst wirkte dieses Aufblühen von Handel und Gewerbe vorteilhaft auf die Lage der englischen Bauern zurück, die ihre überflüssigen Produkte jetzt leichter als vorher versilbern konnten, und mit dem so gewonnenen Gelde schon im dreizehnten Jahrhundert begannen, sich aus dem gutsherrlichen Verbande loszukaufen, um eine freie Bauernschaft zu werden. Da kommt mit den Jahren 1348/49, 1361/62 und 1368/69
das „Grosse Sterben“ nach England, der
Die englische Bauernschaft war damit zwischen zwei
Mühlsteine gekommen. Auf der einen
Seite die alten Grundherren, welche infolge des
Arbeitermangels nicht nur kein weiteres Loskaufen der
Bauern aus dem Gutsverbande gestatteten, sondern auch die
bereits freigekauften Bauern zu Arbeitsleistungen auf der
Gutsherrschaft zurückzuzwingen bemüht waren,
und für diese Leistungen eine ihren
Verhältnissen angepasste gesetzliche Lohntaxe
erwirkt hatten — auf der anderen Seite
die beginnende Ausdehnung der Latifundien für
Schafhaltung, die natürlich von Anfang an dort am
wenigsten Halt machte, wo ein freier Bauernhof im Wege
lag. Das kurz vorher erwachte Selbstbewusstsein der
Bauern wurde durch alles das natürlich tief
verletzt. Im Jahre 1381 kam es deshalb zu dem ersten
grossen Bauernaufstand unter Wat Tyler und Jack Straw.
Nach dessen Niederwerfung wurden auch die freien Bauern
noch Das Schicksal des englischen Bauernstandes war damit
entschieden. Das Land wurde von nun an ausschliesslich
nach kapitalistischen Gesichtspunkten regiert und
verwaltet. Um auch der Wollmanufaktur wenigstens
eine Art unfreier Arbeiter zu liefern, hat
man unter Eduard VI. (1547 bis 53) durch
Gesetz den siebenjährigen Lehrzwang eingeführt.
Und als auch dieses Mittel nicht zu genügen schien,
die vom Grund und Boden losgerissenen und seit Die Interessen der Wollmanufaktur wurden
in der denkbar sorgsamsten Weise gesetzlich
geschützt. Nach der Auslieferung des
landwirtschaftlichen Grundbesitzes an die Wollproduktion
hat man durch die vorgenannten Gesetze das auf die
Lohnarbeit angewiesene Volk gefügig gemacht und das
Verbot der Einfuhr fremder Wollwaaren in strengster Weise
gehandhabt; Uebertretungen des Verbots der Ausfuhr von
Schafen, Lämmern und Böcken wurden im
Wiederholungsfalle mit dem Tode bestraft und das Verbot
der Ausfuhr von Wolle für Verkäufer wie
Schiffseigentümer hart geahndet. Dazu kam ein ganzes
System von Verhütungsmassregeln dieser verbotenen
Handlungen. Wolle durfte im Inlande nur in Ballen von
Leder oder Packleinwand, auf deren Aussenseite in drei
Zoll langen Buchstaben das Wort „Wolle“
stand, verpackt und nur zwischen Auf- und Niedergang der
Sonne zu Pferd oder Wagen transportiert werden. Jeder
Besitzer von Wolle innerhalb zehn Meilen von der
Küste musste binnen drei Tagen nach der Schafschur
dem nächsten Zollbeamten die Anzahl der Fliesse und
deren Aufbewahrungsort, und bevor er davon etwas
wegschaffte, Zahl und Gewicht der Fliesse, Namen und
Wohnort des Käufers sowie den Bestimmungsort des
Transports schriftlich anzeigen. Verboten war ferner die
Ausfuhr Den Aufgaben der Getreidepolitik
gegenüber war diese geldwirtschaftliche Ordnung der
volkswirtschaftlichen Verhältnisse lange Zeit
hindurch ziemlich ratlos. Man versuchte es mit dem
Einfuhrverbot, mit Schutzzöllen in der
verschiedensten Höhe wie mit Freihandel, und keine
dieser Massregeln konnte die Beunruhigungen durch
Hungersnotrevolten beseitigen. Da kam man gelegentlich
des Regierungsantritts des Oraniers Wilhelm
III., des Königs „von Parlamentes
Gnaden“, im Jahre 1698 auf den Gedanken, auch
die Getreideproduktion — nach den
herrschenden merkantilistischen Grundsätzen —
durch Exportprämien in Verbindung mit hohen
Einfuhrzöllen in ein Exportgewerbe zu
verwandeln. Um dem Könige die Zahlung dieser
Exportprämie zu ermöglichen, wurde die
Einführung einer allgemeinen Grundsteuer
zugestanden. Und um auch die Interessen des englischen
Handels und der englischen Rhederei mit dieser Massregel
zu verknüpfen, wurde bestimmt, dass diese
Exportprämie für Getreide im Betrage von etwa
16% der damaligen Weizenpreise
nur dann gezahlt werde, wenn der Schiffseigentümer
und mindestens 2⁄3 der Schiffsmannschaft englische
Unterthanen Die rücksichtslose Begünstigung der Fabrikanteninteressen war in der Gesetzgebung allgemein durchgeführt worden. So hatte man z. B. den Zoll auf gebleichtes Garn abgeschafft, die Ausfuhr von fertiger Leinwand durch Prämienzahlung begünstigt und die Einfuhr von fremdem Leinen durch hohe Einfuhrzölle gehemmt. Die Ausfuhr von rohen Häuten und gegerbtem Leder war verboten, ebenso die Ausfuhr von rohen Tüchern — die sollten erst im Lande gefärbt werden —, wie auch die Schuhe im Lande verfertigt werden sollten. Verboten war ferner die Ausfuhr von Metallen, die Ausfuhr von Werkzeugen, von gelernten Arbeitern u.s.w. Das ganze englische Reich schien nur zu dem Zwecke gegründet zu sein, eine Nation von „Kunden“ aufzuziehen, die aus den Werkstätten der englischen Fabrikanten alles, womit diese sie versorgen können, zu möglichst hohen Preisen kaufen müssen. Um die Gewinne der Fabrikanten und Händler thunlichst zu mehren, wurden dem ganzen Lande die Kosten von Millionen für Kriege aufgebürdet, die mit Soldtruppen gegen Holland, Spanien und Frankreich geführt wurden, um diesen Ländern ihren wertvollsten Kolonialbesitz, der ein höchst ergiebiges Ausbeutungsobjekt war, zu entreissen. Wo auch nicht gleichzeitig sogenannte „höhere politische Gesichtspunkte“ noch hinzukamen, griff der Staat ohne jedes Bedenken zum Krieg, als Mittel zur Bereicherung der englischen Unternehmer. So führte England z. B. im Jahre 1755 einen Krieg mit Senegal, um für die englischen Kaufleute dort das Gummi-Monopol zu erwerben.
Nicht minder einschneidend hatten sich die Verhältnisse der Getreideversorgung geändert. Der grosse europäische Getreidehandel, welcher in Russland, Polen, Livland und Preussen seine Massen sammelte, um sie fast der ganzen europäischen Meeresküste entlang zu verfrachten, besass in dem England nahe gelegenen Freihafen Amsterdam einen Centralstapelplatz, in welchem immer solche gewaltige Getreidemassen umgeschlagen wurden, dass auch für England die Gefahr einer Hungersnot im Falle einer ungenügenden inländischen Ernte ausgeschlossen schien. Die Notwendigkeit, den nationalen Getreidebau aus Furcht vor Hungersnotrevolten als eine mit Prämien begünstigte Exportindustrie von Staatswegen zu behandeln, war also damit entschwunden. Statt dessen lag der Gedanke, auch die englischen Häfen in Hauptstapelplätze des internationalen Getreidehandels umzuwandeln, jetzt um so näher, je neidischer längst England den Reichtum betrachtete, welchen die Holländer gerade aus den internationalen Getreidegeschäften bis dahin zu ziehen wussten. Die entscheidende Wendung nach dieser Richtung war
bereits im Jahre 1765 hervorgetreten. Die Fortschritte in
Gewerbe und Industrie hatten die englische
Bevölkerung rasch Unter diesen Zeitverhältnissen schrieb Adam Smith sein berühmtes Werk über „Wesen und Ursache des Nationalen Reichtums“. Die Schwankungen in der englischen Getreidepolitik dauerten weiter. Die Weizenpreise stiegen 1782 bis 1784 auf durchschnittlich 54 s. per Quarter (M. 245 per 1000 Kilo) im Jahre 1789 auf 59 s. (M. 258,70 per 1000 Kilo). Die englischen Armenlasten wuchsen von durchschnittlich 713'000 £ auf 1'300'000 im Jahre 1770, auf 2'700'000 im Jahre 1790, auf 3'800'000 im Jahre 1800. Die Frage einer zweckmässigeren Regelung der Armenverhältnisse kam auf die Tagesordnung der gesetzgebenden Körperschaften. Und jetzt veröffentlichte Thomas Robert Malthus (1798) seinen „Versuch über die Bevölkerungsprincipien und deren Einfluss auf die Wohlfart der Menschen“.
Nachdem es unbestritten war, dass das Ziel und die
Aufgabe aller Wirtschaftspolitik darin bestehe, die
Völker reich und reicher zu machen, und nachdem
schon Quesnay und seine Schule erkannt
hatten, dass der Reichtum eines Volkes nicht dem Vorrat
an Geld, sondern dem Vorrat an jenen Gütern gleich
sei, welcher dem Volke zu Konsumzwecken zur
Verfügung stehe, war jetzt die naheliegende Frage
der Theorie offenbar die Frage nach der Diese nach Adam Smith naturgemässe Entwicklung der volkswirtschaftlichen Verhältnisse wurde zu seiner Zeit vor Allem aufgehalten durch die bevormundende Einmischung des Staates in die wirtschaftliche Thätigkeit des Einzelnen, die insbesondere deshalb geradezu verhängnisvolle Wirkungen zeigte, weil die Reichsten die Staatsgewalt missbrauchten, um die Schwächeren noch mehr zu unterdrücken und die Massen des Volkes in rücksichtslosester Weise durch Monopole aller Art auszubeuten. Adam Smith kann deshalb nach seinem Empfinden gar nicht häufig genug den Nachweis erbringen, dass das wohlverstandene eigne Interesse des Einzelnen die beste Triebfeder aller volkswirtschaftlichen Entwicklung sei und dass der Staat nichts zweckmässigeres thun könne, als eben diese Triebfeder endlich frei zu geben. „Zweck und Ziel aller Produktion ist die
Konsumtion und das Interesse der Produzenten sollte nur
so weit berücksichtigt werden, als zur
Förderung der Interessen der Konsumenten nötig
ist. Dieser Grundsatz ist so einleuchtend, dass es
abgeschmackt wäre, ihn beweisen zu wollen. In den
merkantilistischen Privilegien aber, welche man einzelnen
Industriezweigen erteilt hat, wird das Interesse der
Konsumenten fast beständig dem der Produzenten
aufgeopfert, und dabei scheint man die Produktion und
nicht die Konsumtion als Endzweck allen Gewerbefleisses
und Trotzdem sind alle diese Begünstigungen, welche man der Industrie zugewendet hat, längst nicht im gleichen Masse schädlich als jene, welche vorgeblich den inländischen Getreidebau fördern. „Der grössere Gewinn der Fabrikanten gestattet wenigstens, mehr Arbeiter zu beschäftigen. Das Getreideausfuhrprämiengesetz aber mit den hohen Getreideschutzzöllen hat nur nachteilige Wirkungen.“ „Jede Steuer auf Getreide muss entweder die Nahrungsmenge der Arbeiter reduzieren oder eine der Erhöhung des Geldpreises für Getreide entsprechende Erhöhung der Geldlöhne veranlassen. Im ersteren Falle werden die Arbeiter weniger Kinder erzeugen und wird also ein Rückgang der Bevölkerung eintreten, im anderen Falle wird der Arbeitgeber gezwungen, bei höheren Löhnen mit seinem Kapital weniger Arbeiter zu beschäftigen, als niedrigere Löhne gestatten würden, und damit wird dann der Gewerbefleiss des Landes eingeschränkt.“
„Die merkantilistische Politik der Prämien auf die Getreideausfuhr und der Zölle auf die Getreideeinfuhr musste deshalb dazu führen, in England die Getreidepreise zu steigern und im Auslande sie etwas zu verbilligen. Damit wurden aber alle englischen Waren auf allen Märkten etwas teuerer und die ausländischen Waren umgekehrt etwas billiger, als es sonst der Fall gewesen wäre, und man gab folglich der ausländischen Industrie einen doppelten Vorsprung über die englische. Den Grundbesitzern allerdings bringen zunächst höhere Getreidepreise etwas mehr Geld in die Tasche, aber, nachdem infolge dieser höheren Geldpreise für Getreide die Preise für ihre heimischen Produkte entsprechend steigen, sind auch für sie die Vorteile dieser höheren Geldeinnahme nur imaginär.“ „Den Geldpreis von Getreide künstlich
steigern heisst also, eine beständige Verteuerung
hervorrufen. Die Politik „Die tiefere Einsicht in diese Verhältnisse fordert deshalb den Freihandel nicht nur für die industrielle und gewerbliche Produktion, sondern insbesondere auch den Freihandel für Getreide. Dadurch wird die Gefahr einer Hungersnot am Besten vermieden, denn der Freihandel in Getreide macht die verschiedenen Länder gewissermassen zu Provinzen eines grossen Versorgungsgebietes. Hier kann dann selbst bei ungünstigster Witterung der veranlasste Mangel kein grosser sein. Entweder ist die Witterung zu trocken, dann geben die zu feuchten Ländereien um so bessere Erträge, oder die Witterung ist zu nass, dann geben die zu trockenen Ländereien bessere Erträge und gleichen so den Minderertrag auf den anderen Flächen wesentlich aus. Speziell für die Industriestaaten bietet es nicht die geringsten Schwierigkeiten, die erforderlichen Nahrungsmittel einzutauschen. Das freihändlerische Holland z. B. bezieht lebendes Vieh aus Holstein und Jütland und Getreide fast aus allen europäischen Ländern und muss dafür im Austausch nur eine verhältnismässig kleine Menge von seinen weit wertvolleren industriellen und gewerblichen Produkten hingeben.“ Also Freihandel möglichst auf allen Gebieten des wirtschaftlichen Lebens. Dieser Freihandel ist jedoch bei Adam Smith nicht blind und nicht bedingungslos. Demselben liegt vielmehr eine ganz bestimmte bessere volkswirtschaftliche Ordnung zu Grunde, die sich der Idee nach aus dem Princip der Arbeit ableitet. Die Arbeit ist nämlich der einzig
normale und naturgemässe Massstab jenes
Wertes, zu dem die Arbeitsprodukte auf
dem freien Markte gegen einander
ausgetauscht werden. So sollen die
natürlichen Getreidepreise nach Adam
Smith Wesentlich anders verhält es sich nach Adam Smith mit der natürlichen Preisbewegung für industrielle Produkte. Hier geht die naturgemässe Entwicklung bei fortschreitender Kultur infolge Arbeitsteilung, verbesserter Arbeitsmaschinen, Verbilligung des Zinses u.s.w. dahin, den Preis fast aller Manufakturwaren immer mehr herabzusetzen. Hohe Preise mit steigender Tendenz für Ackerbauprodukte und billige Preise bei fallender Tendenz für industrielle Produkte sind also nach Adam Smith die Merkmale einer höheren und fortschreitenden Kultur. Der Wertbegriff von Adam Smith begnügt sich nicht mit der Thatsache des Preises, er deckt sich nicht mit dem „Verkehrswert“, sondern findet in bewusster Weise seinen normalen selbständigen Massstab im Buchwert. Endlich begnügte sich Adam Smith nicht mit dem
rein negativen „laissez faire“
der Physio Das Produkt der Arbeit ist auch nach Adam
Smith der naturgemässe Arbeitslohn. Und
früher, als es noch keine Latifundienbesitzer und
noch keine Grosskapitalisten gab, da war in England
dieser ideale Zustand reale
Wirklichkeit, mit anderen Worten: damals war
in England der Mittelstand allgemein
verbreitet, dessen inneres Wesen darin besteht, dass der
Arbeiter auch Eigentümer seiner Produktionsmittel
ist. Deshalb gehörte ihm sein Arbeitsprodukt als
Arbeitslohn. Inzwischen war das im Verlauf der englischen
Geschichte leider anders geworden. Der Mittelstand war
mit dem Bauernstand fast vollständig verschwunden,
es kam nur „manchmal noch vor, dass
ein einzelner unabhängiger Arbeiter genügend
Mittel hatte, um die nötigen Materialien zu kaufen,
und sich bis zur Vollendung der Arbeit zu
unterhalten.“ Die englische Gesellschaft trennte
sich zur Zeit von Adam Smith in Grundbesitzer,
Grosskapitalisten und besitzlose Arbeiter. Deshalb,
— so folgert Adam Smith — erhält heute
der Arbeiter nur den
Arbeitslohn aus dem gesamten Wert des
Arbeitsproduktes, während ausserdem noch für
den Unternehmer der
Kapitalgewinn und für den
Grundeigentümer die
Grundrente Bis vor Adam Smith verstand man unter
Kapital in der Regel eine Geldsumme, die
gegen Zinsen ausgeliehen wurde und der der sittliche
Makel des Wuchers anhaftete. Man kann in diesem Sinne das
Wort „Kapital“ definieren als eine Geld- oder
Güter-Summe, die in habsüchtiger Weise
verwendet wird. Indem nun Adam Smith seinen
Reichtumsbegriff nicht nur auf das Geld, sondern auf alle
stofflichen Güter ausdehnte und von der Arbeit als
Quelle des Reichtums ausging, wurde durch die fasst
ausschliessliche Betrachtung des Geldes in seiner Wirkung
bei dem Produktionsprozess der Güter das
Kapital jetzt zu „angesammelten
Arbeitsprodukten, welche zur Deckung des
Lebensunterhaltes der Arbeiter (Lohnzahlung)
während der Dauer des Produktionsprozesses,
wie zur Verwertung der Produkte auf dem Markte, wie zur
Beschaffung der erforderlichen Rohmaterialien mit
Maschinen und Werkzeugen verwendet wurden“.
Die Grösse des Kapitalvorrates begrenzte so die Zahl
der im Produktionsprozess möglicherweise
verwendbaren Arbeiter, sie bedingte damit auch den Grad
der Vollkommenheit der Arbeitsteilung und so nicht
zuletzt die Grösse des Produktionserfolges
überhaupt. Mit dieser Grösse des
Produktionserfolges aber steigt der Reichtum der Nation
und also auch der Lohn der Arbeiter. Mithin sind die
angesammelten Kapitalvorräte gewissermassen als:
„milde Stiftung im In der Erinnerung an die Geschichte des
Kapitalismus in England scheint jedoch auch Adam
Smith bei dieser seiner Kapitaldefinition etwas
bedenklich geworden zu sein, denn er versäumte es
nicht, den Staatsregierungen folgende ernste Mahnung zu
hinterlassen: „Das Interesse des
grundbesitzenden Landwirtes — der von dem
„auch“ Grundeigentum besitzenden
Grosskapitalisten scharf zu trennen ist — steht im
engen unzertrennlichen Zusammenhange mit den allgemeinen
Interessen der ganzen Gesellschaft. Was zur
Förderung oder Beeinträchtigung des einen
dient, fördert und beeinträchtigt auch die
anderen. Beratschlagt das Volk über Gesetze für
Handel und Politik, so können diese Grundbesitzer es
niemals irreleiten, um ihre eigenen Sonderinteressen zu
fördern, wenigstens dann nicht, wenn sie dieses
Interesse einigermassen kennen. Ebenso innig ist
das Interesse der Arbeiter mit dem der
übrigen „Da sie während ihres ganzen Lebens sich
mit Plänen und Berechnungen beschäftigen, so
ist ihr Verstand in der Regel mehr geschärft als bei
den meisten Landedelleuten; aber, da ihre Gedanken in der
Regel mehr auf das, was ihrem eigenen Geschäfte, als
auf das was der Gesellschaft im allgemeinen frommt,
gerichtet sind, so kann man auf ihr Urteil, selbst wenn
es mit der grössten Unbefangenheit abgegeben wird,
was nicht immer geschieht, mehr bauen, wenn es den
ersten, als wenn es den letzten dieser Gegenstände
betrifft. Ihre Ueberlegenheit über den Landedelmann
besteht nicht sowohl darin, dass sie das
öffentliche Interesse, als darin, dass
sie ihr eigenes besser verstehen als er das
seinige. Durch diese Art der Ueberlegenheit haben sie oft
seine Grossmut gemissbraucht, und ihn zur Preisgebung
seines eigenen wie des öffentlichen Interesses zu
bewegen vermocht, indem sie ihm einredeten, In der Steuerpolitik verlangt Adam Smith,
dass die Unterthanen möglichst nach dem
Verhältnis ihres Vermögens und ihres Einkommens
Steuern zahlen sollten. Diese Steuerpflicht soll durch
das Gesetz möglichst genau und klar bezeichnet
werden, sodass der Willkür der Steuereinnehmer kein
Raum gelassen ist. Die Steuererhebung soll sich den
Verhältnissen der Steuerzahler derart anpassen, dass
die Steuerleistung möglichst erleichtert werde. Der
Steuerzahler soll auch der Steuerträger sein und
nicht die Steuern auf andere Schultern
überwälzen können. Endlich sollte die
billigste Erhebungsform gewählt werden. Als
prinzipieller Gegner des Merkantilsystems ist er gleich
Quesnay nicht minder entschieden gegen alle
indirekten Steuern und Gebühren, welche,
soweit sie bestehen, möglichst bald abgeschafft
werden sollen. Am meisten empfehlenswert scheint ihm eine
Art Grundrentensteuer auf städtischen und
ländlichen Grundbesitz, welche überdies den
Vorzug habe, dass sie eine Art Einkommen So viel von den Theorien von Adam Smith.
* * *
Alle jene wirtschaftlichen Störungen, welche den französischen Revolutionskriegen voraus und in verstärktem Masse neben ihnen einhergingen, haben den nüchternen Beobachter und Denker Robert Malthus erkennen lassen, dass die Schwärmereien eines Wallace, Godwin und Condorcet über die mögliche Vervollkommnung der menschlichen Verhältnisse durch die technischen Fortschritte im Produktionsprozess und Verkehr, und durch die Fortschritte der Wissenschaft nur geeignet seien, höchst gefährliche Irrtümer zu verbreiten. Trotz, oder richtiger gesagt, wegen eben dieser Fortschritte in England, wurde jetzt die Stockung in dem Absatz industrieller Produkte um so empfindlicher und die Steigerung der Getreidepreise um so höher. Das englische Armengesetz aber setzte aller wirtschaftspolitischen Unvernunft die Krone auf. Denn: indem es die Kirchspiele verpflichtete, einem jeden arbeitsfähigen Armen Beschäftigung, jedem Armen einen angemessenen Unterhalt zu verschaffen und die hierzu nötigen Mittel durch Steuern zu erheben, wurde in recht gedankenloser Weise das bestehende Missverhältnis zwischen der Bevölkerungszahl und den Nahrungsmitteln beibehalten und noch mehr verschärft. Einer solchen wenig durchdachten Wirtschaftspolitik
gegenüber, wies Robert Malthus vor
allem darauf hin, dass die Proletariermassen das Streben
hätten, sich in geometrischer Progression zu
vermehren, wie 1 zu 2 : 4 : 8 : 16 u.s.w., während die Nahrungsmittel
höchstens in arithmetischer Reihe wie 1 zu 2 : 3 : 4
: 5 zur Verfügung ständen. Deshalb trete von
Zeit zu Zeit ein Miss Für Robert Malthus war die
wirtschaftliche Freiheit des Einzelnen nur
ein anderer Ausdruck für die wirtschaftliche
Selbstverantwortlichkeit des Einzelnen. Wenn in
dem Zustand der wirtschaftlichen Freiheit der Einzelne
sich nicht selbst helfen und sich nicht selbst
ernähren kann, dann können ihm auch Staat und
Gesellschaft nicht helfen. Aber Malthus war
bei dieser Auffassung sich wohl bewusst, dass der
Staat und die Gesellschaft
gleichzeitig allerdings dafür
verantwortlich seien, eine solche Politik zu
treiben, dass dem Einzelnen die Erfüllung seiner
Pflicht der ökonomischen Selbstverantwortlichkeit
nicht etwa erschwert oder gar
unmöglich gemacht werde.
Malthus vertrat in diesem Zusammenhange
insbesondere die Ueberzeugung, dass der Staat jedes
einseitige Ueberwuchertwerden der Landwirtschaft durch
die Industrie verhüten müsse. England
sei in der Richtung einseitiger Begünstigung der
industriellen Entwickelung auf Kosten der Landwirtschaft
schon viel zu weit gegangen. In diesem Sinne
sei allerdings der Staat verantwortlich für die
Leiden der Armen, weil man durch seine Massnahmen und
durch seine So viel aus den Theorien von Robert Malthus.
* * *
Während Adam Smith und Robert Malthus ihr volkswirtschaftliches Gebäude zuletzt auf der heimischen Landwirtschaft ruhen liessen, und trotz aller Neigung für den kapitalistischen Produktionsprozess gegen die Alleinherrschaft des Kapitalismus laut ihre warnenden Stimmen erhoben haben, versteht es der Grosskapitalist David Ricardo in recht wirksamer Weise, durch seine Grundrententheorie einen Keil zu treiben zwischen die wirtschaftlichen Interessen der Grundbesitzer und die Interessen der übrigen Bevölkerung. Diese Theorie lautet folgendermassen: Wenn der Boden bester Qualität in genügender
Menge vorhanden ist, um das Brotgetreide für das
Volk darauf zu bauen, dann bestimmen die
Produktionskosten den Preis und darüber hinaus giebt
es jetzt keinen Gewinn und keine Grundrente. Wenn aber
dieser beste Boden nicht mehr ausreicht, das Volk mit
Getreide zu versorgen, weil durch den Andrang der
Bevölkerung die Nachfrage nach Getreide über
seine Produktionsleistungen hinaus gewachsen ist,
dann müssen die Getreidepreise
steigen und zwar so hoch, dass die
Produktionskosten der schlechtesten, noch
zur Deckung des Getreidebedarfes notwendig unter den
Pflug zu nehmenden Bodenklasse damit noch
gedeckt werden. Hiermit ist dann für die
besseren, ursprünglich allein mit
Getreide bebauten Böden ein besonderer
Gewinn entstanden, der als
„Grund
* * *
Erst durch diese Art der Ausscheidung des
Grundbesitzes aus der engeren harmonischen
Interessenverbindung der Volkswirtschaft war die
Interessenpolitik des Kapitalismus zur Allein -
Herrschaft gelangt, die nun ihren theoretisch
konsequenten Ausdruck in den „Lehren der reinen
Freihandelsschule“ gefunden hat. Jede genauere
Untersuchung der konkreten Verhältnisse und ihres
geschichtlichen Werdeprozesses war jetzt
überflüssig geworden. Es genügte, nach der
von Ricardo eingeführten abstrakten
Methode zu allgemein gültigen Normen für die
Volkswirtschaftspolitik zu kommen, die thatsächlich
nur das eine Ziel erstreben: den Interessen des
spekulativen Privatkapitals zu dienen. Dies, und
nicht der Grundsatz der individuellen Freiheit So wurde jetzt die Nationalökonomie gelehrt von „reinen“ Theoretikern, wie MacCulloch, James Mill und Senior in England, von J. B. Say, L. L. F. Faucher, Bastiat u. A. in Frankreich, Prince-Smith, Michaelis, Max Wirth u. A. in Deutschland. Für die Nationalökonomen dieser Art kamen die Zeitverhältnisse nur insofern in Betracht, als sie der Ausbreitung der Kapitalsherrschaft günstig waren. Jede Beurteilung des kapitalistischen Freihandels - Systems wird vor Allem anerkennen müssen, dass der Vater desselben, Adam Smith, in bewundernswerter Weise die tieferen ökonomischen Bedürfnisse seiner Zeit erkannt hat. Von dem Jahre 1776 an bis in unsere Tage herrschen diese Theorien in durchaus massgebender Weise. Und wenn heute jemand glauben wollte, die schutzzöllnerischen Ideen hätten die Freihandelslehre verdrängt, so sollte ein Hinweis auf die der internationalen Handelsvertragspolitik beigelegte Bedeutung genügen, um uns zu lehren, wie tief noch allgemein die Theorie von der internationalen Arbeitsteilung uns in den Knochen steckt und dass Schutzzoll und Freihandel für sich allein keine prinzipiellen ökonomischen Gegensätze wissenschaftlicher Art, sondern zunächst nur persönliche Interessengegenstätze bezeichnen. Jede historische Betrachtung der Freihandelsepoche
wird bestätigen müssen, dass eine Periode der
Herrschaft des spekulativen Privatkapitals aller
Wahrscheinlichkeit nach in der Entwicklungsgeschichte
keines höheren Kulturvolkes entbehrlich ist. Wenn es
die Aufgabe des Merkantilsystems war, die überlebten
stadtwirtschaftlichen Kreise niederzulegen, die
Volkswirtschaft einheitlich zu organisieren und die
Produktivkräfte des Volkes auf grössere
Leistungen vorzubereiten, so war es die Aufgabe des
freihändlerischen Kapitalismus, eben diese
Produktivkräfte zur vollen Entfaltung zu bringen.
Was nach dieser Richtung, wie nach der Richtung der
Organisation des Verkehrs und des Geld- und Bankenwesens
geschaffen wurde, das hat nur die eiserne Thatkraft der
Einzelnen in der unersättlichen Jagd nach Reichtum
und Gewinn zu leisten vermocht. Und nicht zuletzt ist
eben dieser Reichtum, den die kapitalistische Epoche des
Freihandels geschaffen, eine der wesentlichsten
Voraussetzungen für jene neue volkswirtschaftliche
Ent Die Kritik aber, welche sich bemüht, auch hier das Dauernde von dem Vergänglichen zu trennen, wird notwendigerweise mit dem ersten Satze des Adam Smith’schen Hauptwerkes beginnen, der bekanntlich lautet: „Die jährliche Arbeit eines Volkes ist der Fond, welcher dasselbe mit allen Bedürfnissen und Annehmlichkeiten des Lebens versorgt, die es jährlich verbraucht und die immer entweder in dem unmittelbaren Erzeugnis der Arbeit oder in demjenigen bestehen, was für diese Erzeugnisse von anderen Völkern gekauft wird.“ Ist dieser Satz richtig? Zunächst wird zu
ergänzen sein, dass die Völker gelegentlich
auch Arbeitsprodukte aus früheren Jahren verbrauchen
und dass also der Verbrauch nicht an die Produktion des
laufenden oder vorhergehenden Jahres gebunden ist. Im
Sinne der Adam Smith’schen Terminologie steckt
diese frühere Arbeit in dem Begriff Kapital, das in
seinen Teilen ja aus Arbeitsprodukten besteht. Aber damit
wird der Begriff Arbeit im Produktionsprozess noch nicht
erschöpft. Die Arbeitskraft, welche in den Maschinen
und Werkzeugen der höher entwickelten Kultur
enthalten ist und die durch das Hinzutreten der
lebendigen Arbeit des anwesenden Menschen in Aktion
tritt, beschränkt sich nicht auf die
Jahresleistungen und nicht auf die schwielige Hand des
Lohnarbeiters. Wenn wir den Arbeitsbegriff an dem
Dampfhammer, an der Bänder - Maschine, an dem
modernen Webstuhl, an dem Dampfpflug u.s.w. richtig analysieren, so kommen wir auf
den grossen und gewaltigen Begriff der
Arbeitsgemeinschaft der Menschheit, der in
seinen Zusammenhängen bis über die Stein- und
Broncezeit hinausreicht und nicht nur die Leistungen der
schwieligen Fäuste, sondern auch insbesondere alle
Fortschritte von Kultur und Wissen Diese soziale Arbeitsgemeinschaft ist der grundlegende Teil des Begriffes der ökonomischen Arbeit. Indem Adam Smith den rein technischen Begriff der Arbeitsteilung an die Spitze seiner Betrachtungen stellte, hatte er von Anfang an eine viel zu enge Basis gewählt. Und diese zu enge Begrenzung seiner Aufgabe hatte zur weiteren Folge, dass ihm die Arbeit als alleinige und eigentliche Quelle des Reichtums erscheinen konnte. Die Arbeit der Menschheit als Ganzes hat selbstverständlich für die Schaffung des materiellen ökonomischen Reichtums die Erde zur unentbehrlichen Voraussetzung. Alle Stoffe, die wir besitzen und die wir Güter nennen, müssen einmal irgend wo und irgend wann der Erde entnommen worden sein. Deshalb müssen wir schon den ersten Adam Smith’schen Satz dahin abändern, dass wir sagen: Die Erde ist die Quelle, aus welcher die menschliche Arbeit jene Stoffe gewinnt, die in den verschiedenen Graden ihrer Veredelung die Gesamtheit jener Gütermengen ausmachen, die wir den Reichtum des Volkes nennen. Adam Smith ist gleichzeitig in diesen seinen
grundlegenden Ausführungen zu sehr in den
Verhältnissen seiner Zeit hängen
geblieben. Weil zu seiner Zeit England den
übrigen Völkern technisch in Adam Smith bezieht sich bekanntlich auf das Beispiel eines Manschettenmachers, der aus einer Flachsmenge im Werte von nur 8 Pfg. eine kunstvolle Spitzenmanschette im Werte von 60 M. herstellen kann und dann auf dem freien Markte für ein kleines Volumen seines veredelten Produktes leicht grosse Massen billiger Nahrungsmittel und Rohprodukte von anderen Völkern einzutauschen vermag. Das scheint zunächst ganz einleuchtend. In Wahrheit aber hat diese Politik der internationalen Arbeitsteilung drei wichtige Dinge zur Voraussetzung:
Dass die Theorie der internationalen Arbeitsteilung nach diesen drei Seiten auf recht unsicherem Boden steht, lässt sich leicht beweisen. Das englische Volk hat schon zur Zeit der
Kontinentalsperre recht hart empfinden
müssen, wie gefährlich der damals erreichte
Grad der internationalen Arbeitsteilung für Leib und
Leben der einheimischen Arbeiterbevölkerung war. Der
Absatz der industriellen Zunächst wird auch hier wieder die gerechte
Beurteilung anerkennen, dass man zur Zeit von Adam Smith
den Eindruck haben konnte, die Weizenpreise
würden sich dauernd über 200 M. p.
1000 kg, also dauernd auf der Höhe der bekannten
„Kanitzpreise“ halten,
während zu etwas billigeren Preisen in dem
benachbarten Amsterdam anscheinend beliebige Mengen von
Brotgetreide gekauft werden konnten. Dass man unter
solchen Umständen vor eineinviertel Jahrhundert in
dem industriell Diese unbedingte Anerkennung der Adam Smith’schen Stellungnahme vorausgeschickt, sind wir heute auf Grund der inzwischen neu gesammelten Erfahrungen in der Lage, in den Adam Smith’schen Argumenten zu Gunsten eines internationalen Handels in Getreide folgende Irrtümer nachzuweisen. Die Getreideernte leidet nicht nur unter dem Einflusse
der Trockenheit und der Nässe, sie leidet auch unter
dem häufig noch schärfer auftretenden Einfluss
der Kälte. Auch grössere Produktionsgebiete
schliessen das unerwünschte Ereignis einer Missernte
nicht aus. So hatte das Weizenproduktionsgebiet der Erde
innerhalb der letzten 26 Jahre sieben schlechte Ernten,
nämlich in den Jahren 1876, Es können indessen auch Fälle eintreten, in denen durch andere Faktoren die Zufuhr von Brotgetreide verhindert wird. Einen solchen Fall hatte die englische Geschichte schon bald nach Adam Smith zur Zeit der Napoleonischen Kriege und der Kontinentalsperre zu verzeichnen, als die Preise für 1000 kg Weizen auf 708,80 M. stiegen! Als im Winter 1895/6 ein kriegerischer Konflikt zwischen England und den Vereinigten Staaten von Nordamerika drohte, brachte die englische Tagespresse Hunderte von Leitartikeln über das Thema: „Krieg zwischen England und Amerika, England muss sich binnen vier Wochen ergeben“ — aus dem ganz einfachen Grunde, weil England in seiner Brotversorgung auf Nordamerika angewiesen sei. Die Adam Smith’sche Theorie der internationalen
Arbeitsteilung hat übersehen, dass England nicht der
einzige Industriestaat auf der Welt bleiben konnte. Alle
Märchen über die natürliche Ueberlegenheit
und über das natürliche Monopol von England hatte die Unrichtigkeit dieser Theorie zur
Zeit der Napoleonischen Kriege am eigenen Leibe kennen
gelernt und setzte deshalb damals sofort mit einer
energischen Schutzzollpolitik ein, die bis in die
40 er Jahre des vorigen Jahrhunderts andauerte. Dann
begann man allerdings die ernste Lehre der Napoleonischen
Zeit wieder zu vergessen, um erst in unseren Tagen von
Neuem Erwägungen über diese drohenden Gefahren
anzustellen. Der Sozialist Robert Blatchford
schreibt in seinem „Merie England“, das eine
Verbreitung in weit über eine Million Exemplaren
gefunden hat: „Der Kapitalismus, der die englische
Landwirtschaft zerstört hat, hat zugleich auch die
Unabhängigkeit des englischen Staates zerstört.
Noch 20 Jahre des blühenden Robert Malthus hat die für das
englische Volk so schlimmen Zeiten der Napoleonischen
Kriege und der Kontinentalsperre miterlebt. Deshalb war
er in der Lage, die Adam Smith’sche Lehre in
wesentlichen Teilen zu verbessern und zu
ergänzen. Nach seiner Auffassung hat der
internationale Für Robert Malthus ist diese ökonomische Selbständigkeit der Staatsgemeinschaft eine wesentliche Voraussetzung der ökonomischen Selbständigkeit und Selbstverantwortlichkeit der Einzelnen. Nur innerhalb der Grenze des Staates können die Machtmittel desselben bei arbeitsteiliger Produktion einen geordneten gegenseitigen Austausch der Güter dauernd sichern. Je mehr die arbeitsteilige Produktion in wesentlichen Dingen vom Auslande abhängig wird, desto mehr läuft sie Gefahr, durch unberechenbare Ereignisse tiefgehende Störungen zu erleben, zu deren Beseitigung die Machtmittel des Staates nicht mehr ausreichen und für welche dann die Einzelnen schuld- und schutzlos zu leiden haben. Solche Krisen sind speziell der
industriestaatlichen Entwicklung eigen Wer nach Robert Malthus auch hier den Mut
hat, der Wahrheit ins Auge zu schauen, wird als Politiker
— statt dieser verhängnisvollen
Entwicklungstendenz der Krankheit in kurzsichtiger Weise
zu folgen — bemüht sein müssen, dem
volkswirtschaftlichen Körper Die Kritik dieser Malthus’schen
Lehre hat bis heute darauf hinweisen können, dass
für junge Kulturländer, wie
Nordamerika, Argentinien u.s.w. die
Malthus’schen Theorien zur Erklärung der
Krisen nicht verwendbar sind. Man hat auch
mit Recht betont, dass Malthus eigentlich nicht gezeigt
habe, wie der Uebergang aus der einseitig
industriellen Entwicklung zur harmonischen Entwickelung
von Landwirtschaft und Industrie
wirtschaftspolitisch vollzogen werden könnte. Mit
der Abschaffung der armenrechtlichen
Verpflichtungen jeder Art zur Unterstützung
der Hungernden und mit der Einführung
genügend hoher Schutzzölle Dem Adam Smith’schen Kapitalbegriff
gegenüber haben namentlich Rodbertus
und Adolf Wagner schon darauf hingewiesen,
dass mindestens zwischen Kapital im
volkswirtschaftlichen und Kapital im
privatwirtschaftlichen Sinne unterschieden
werden müsse. Wenn es einem Unternehmer gelingt,
seine Lohnarbeiter in rücksichtslosester Weise
auszubeuten, so kann der Reichtum, den er alsdann in
seiner Tasche ansammelt, einer solchen Belastung der
Gesamtheit infolge der Verelendung der Arbeiterfamilien
gegenüberstehen, dass unmöglich eine
gleichzeitige Zunahme des Nationalreichtums angenommen
werden kann. Wenn ein Spekulant an der Börse durch
geschickte Verbreitung falscher Nachrichten eine nach
grossem Styl angelegte Baissespekulation mit reichem
Gewinn zu Ende führt, so haben auf dem
Getreidemarkte z. B. andere Personen das Geld
millionenfach verloren, das der
eine Spekulant dabei gewonnen, während
der ganze Vorgang den nationalen Gütervorrat an sich
völlig unberührt gelassen hat. Wenn ein
Güterschlächter in einer Bauerngemeinde sein
unheilvolles Gewerbe zum Abschluss gebracht hat, so mag
seine Privatbörse eine wohlgefüllte sein, die
nationale Produktion aber hat dieser Mann ganz gewiss
nicht gefördert, sondern C. Menger hat deshalb seine Definition des Kapitals wieder mehr dem Begriff des Kapitalismus und der ursprünglichen und allgemeinen Auffassung des Kapitals angepasst, indem damit das „Vermögen der Erwerbswirtschaft bezeichnet wird, dessen Geldwert Gegenstand unseres ökonomischen Calculs ist und das sich uns rechnungsmässig als eine werbende Geldsumme darstellt.“ Aber auch hierbei scheint Vorsicht von Nöten zu sein. Die mehr als hundertjährige Herrschaft des Adam Smith’schen Kapitalbegriffes ist uns so sehr in Fleisch und Blut übergegangen, dass heute auf der kleinsten landwirtschaftlichen Winterschule den Bauernsöhnen gelehrt wird, den ökonomischen Jahreserfolg der Bauernwirtschaft nach rechnerischem Calcul zu zerlegen in: Grundrente, Kapitalzins und Arbeitslohn. Fast jede landwirtschaftliche Produktionskostenberechnung zählt selbstverständlich zu den Kosten auch die Zinsen des investierten Kapitals. Wo die öffentliche Meinung so gründlich von kapitalistischen Anschauungen durchsetzt ist, da wird es ratsam sein, den allgemeinen Sprachgebrauch nicht als Ausgangspunkt einer wissenschaftlichen Definition zu wählen. Hier scheint es richtiger, auf die Quelle dieses Begriffes bei Adam Smith zurückzugreifen. Da ist es nun vor Allem wichtig, sich zunächst zu
erinnern, dass Adam Smith selbst wohl der unbedingten
Richtigkeit seines Kapitalbegriffes nicht voll vertraute.
Sonst Weiter ist zu beachten, dass Adam Smith beim Kapital ebenso wie bei der Preisbewegung für landwirtschaftliche und industrielle Produkte ganz bestimmte Normen kannte, denen eine gute gesunde volkswirtschaftliche Entwicklung sich möglichst zu nähern habe. Bei gesunden volkswirtschaftlichen Zuständen, wie sie auch in England schon einmal waren, ist nach Adam Smith der einzelne Arbeiter in der Regel auch Eigentümer seiner Produktionsmittel und besitzt genug Vermögen, um sich während der Dauer der Produktion zu erhalten. In diesem Falle ist dann das Arbeitsprodukt der naturgemässe Arbeitslohn. In diesem Normalfalle giebt es weder ein Kapital, noch einen Kapitalzins, noch eine Grundrente, sondern nur naturgemässen Arbeitslohn. Auf dieser Basis lässt sich nun die Lehre vom Kapital folgendermassen anschliessen. Diese normalen Verhältnisse werden häufig in
der Weise gestört, dass Geldbesitzer die Macht
gewinnen, die selbstständigen Arbeiter ihrer
Produktionsmittel zu berauben. So kam es in England schon
Ausgangs des Mittelalters zur Vernichtung des englischen
Bauernstandes hauptsächlich durch die
Wollinteressenten. Dann teilt sich
die natürliche Grundzelle der Volkswirtschaft, der
Mittelstand nämlich, in Arbeit und
Produktionsmittel und es tritt ein Zustand ein, den man
als den kapitalistischen auch deshalb
bezeichnen kann, weil alle grösseren
Produktionsleistungen jetzt unter der Herrschaft und
Oberleitung des spekulativen Privatkapitals stehen, womit
jedoch in keiner Weise gesagt werden darf, dass sich das
spekulative Kapital etwa nur darauf beschränken
würde, den Produktionsprozess Die volkswirtschaftliche Produktion unter der
Herrschaft des Kapitalismus drängt leicht zur
Spezialisierung in der Produktion, zur internationalen
Arbeitsteilung, zur Abhängigkeit vom Auslande
hinsichtlich des Absatzes der industriellen Produkte, wie
hinsichtlich der Getreideversorgung des Volkes und des
Bezuges an Rohstoffen. Da nun in der Zeit einer
anscheinend aufsteigenden Entwicklung die
Proletarierbevölkerung sich immer stark vermehrt, so
tritt zur Zeit der bei kapitalistischer Herrschaft
unausbleiblichen Krisen mit der Stockung der
Getreidezufuhr vom Auslande ein
plötzlicher „Andrang der
heimischen Bevölkerung“ auf dem bis dahin
vernachlässigten heimischen Getreidemarkt ein,
welcher die Getreidepreise jetzt so hoch treibt, dass sie
durch ihre Höhe zur genügenden
Getreideproduktion im eigenen Lande binnen kürzester
Zeit anreizen. In diesem Falle erzielen die
Eigentümer der besseren Böden
einen Extragewinn, der sich mit der
Ricardo’schen Grundrente deckt. Die
Kritik hat mit Recht behauptet, dass unter solchen
Umständen die Beibehaltung des privaten
Grundeigentums sich nicht mehr rechtfertigen lässt.
Die Kritik hätte gleichzeitig noch einen guten
Schritt weiter gehen und sagen können, dass unter
solchen Zuständen die ganze Unhaltbarkeit der rein
kapitalistischen Ordnung der Volkswirtschaft in aller
Schärfe uns entgentritt und dass deshalb die
Wieder Die Litteratur nach David Ricardo hat jedoch diese Schlüsse zunächst nicht gezogen. Ihr schien vielmehr die reinste Darstellung der kapitalistischen Volkswirtschaftslehre die zunächst wichtigste Aufgabe aller ökonomischen Wissenschaft. Sie hat damit heute den Beweis wesentlich erleichtert, dass eine kapitalistische Ordnung des ökonomischen Volkslebens nicht von Dauer sein kann. Die „reinen“ bedingungslosen Freihändler waren bekanntlich der Ansicht, dass die beste Ordnung unserer volkswirtschaftlichen Verhältnisse darin bestehe, die vier wichtigsten Güterkategorien, nämlich die Arbeit, den Grund und Boden, das Geld und die eigentliche Ware dergestalt in freihändlerische „Ware“ zu verwandeln, dass auf all diesen Gebieten alle volkswirtschaftliche Sorge dem spekulativen Privatkapital überlassen werde. Diese bedingungslose freihändlerische Richtung hat bekanntlich in allen modernen Kulturländern den Gesetzgebungsapparat in ihre Gewalt bekommen. Fast überall tragen heute noch die Völker die Fesseln dieser Freihandelsgesetze. Und wie haben diese sich in der Praxis bewährt? All jene furchtbaren Missstände, welche die
freihändlerische Behandlung der Arbeit als „Ware“ zur Folge
hatte, hat den modernen wissenschaftlichen
Sozialismus gezeitigt, der
wirtschaftspolitisch die Verstaatlichung der
Produktionsmittel fordern zu müssen glaubt. Die
heute in Deutschland herrschende
kathedersozialistische Richtung hat sich der
sozialistischen Kritik des Freihandels auf dem Gebiete
der Lohnarbeit angeschlossen. Und seit dem Beginn der
modernen sozialen Gesetzgebung zu Der Güterschlächter, als hervorragendster Repräsentant des Freihandels in Grund und Boden, wird heute in fast allen Kulturländern als eine Persönlichkeit betrachtet, die mehr oder minder scharf unter Polizeiaufsicht gestellt werden muss. In den Alpenländern ausserhalb der Schweiz, wie in den landschaftlich schönsten Teilen der deutschen Mittelgebirge zeigen sich bereits höchst verdächtige Entwickelungen der Latifundienbildung zu Jagdzwecken, sodass es nur noch eine Frage der Zeit sein kann, bis die Gesetzgebung auch hier dem unheilvollen „Kapitalismus“ entgegentreten muss. Dazu kommen fortwährend sich mehrende Gesetze im Sinne einer positiven Ordnung des bäuerlichen Erbrechts, Massnahmen gegen die schwindelhaften Bauspekulationen in den Städten, Bestrebungen zu Gunsten einer Neuordnung der Grundverschuldung u.s.w. All diesen Gesetzen und wirtschaftspolitischen Strömungen aber liegt die eine feste Ueberzeugung zu Grunde: es war ein höchst bedenklicher Irrtum des Freihandels, Grund und Boden als „Ware“ zu behandeln. Die freihändlerische Lehre vom Gelde hat bereits verschiedene Wandlungen
durchgemacht. Nachdem ursprünglich in den
Ländern mit Doppel-Währung die freie
Prägung der beiden Edelmetalle beliebt war, sodass
dem spekulativen Privatkapital auch die Festsetzung des
Metallgeldvorrates überlassen blieb, siegte dann die
Richtung zu Gunsten einer internationalen
Goldwährung, womit in
Doppelwährungsländern die freie Prägung
eingestellt wurde. Die Erklärung für diese
veränderte Auffassung liegt nahe: nicht nur der
internationale Warenverkehr, auch die internationale
Ausbeutung der Völker durch das spekulative Ja nicht einmal bei der eigentlichen Ware konnte die Freihandelslehre ihre Anerkennung bis heute erhalten. Es klang doch so überzeugend fest für jedermann: der Preis der Ware wird am zweckmässigsten bestimmt durch Angebot und Nachfrage auf dem freien Markte. Ist das Angebot zu gross, dann geht der Preis zurück und wirkt einschränkend auf die Produktion. Ist das Angebot zu klein, so steigt der Preis und wirkt anregend auf die Produktion. So wurde die Preisbildung auf dem freien Markte auch zum volkswirtschaftlichen Regulator der Produktion. In der Praxis aber zeigte sich folgendes: Die Preisbildung des freien Marktes unter der Herrschaft des spekulativen Privatkapitals ist keine solche nach weiten festen Gesichtspunkten, sondern in recht nervöser Weise an die tägliche und stündliche Marktsituation gebunden. Die Augenblickssituation des Marktes beherrscht den freihändlerischen Marktpreis. Und weil diese Situation ausserordentlich wechselvoll sich gestaltet, ist die Preisbewegung auf den freien Märkten nie vor Ueberraschungen sicher und deshalb eine fortwährend schwankende.
Der Konsument hat ein recht bedeutendes
Interesse daran, schon im Voraus für eine
möglichst lange Zeit zu wissen, was eine bestimmte
Ware ihn kosten wird. Jede Art von Haushaltung wird damit
wesentlich erleichtert. Nicht minder verlangen die
Interessen der Produzenten die gleiche
möglichste Stabilität der Preise. Nur dann sind
einschneidende Reformen im Produktionsprozess allgemein
möglich und zu rechtfertigen. Weil nun die
Schwankungen in der Tagessituation des Marktes
hauptsächlich in der ungeordneten Ablieferung
der Produzenten an den Markt und in den
Fälschungen der Marktnachrichten durch
das Spekulationsinteresse verursacht werden, beginnen
neuerdings die Produzenten eine bessere
Ordnung des Marktes in der Weise zu schaffen, dass sie
sich an der Organisation des Nachrichtendienstes
über und für den Markt wesentlich beteiligen,
dadurch Nachrichtenfälschungen bedeutend erschweren
und endlich auf Grund dieses Nachrichtendienstes die
Zufuhren zu dem Markte gemeinsam in Das ist der heute ganz allgemein erkennbare Entwickelungszug bei fast allen Waren, und deshalb muss gesagt werden: selbst für die Ware im eigentlichen Sinne hat unsere Zeit schon begonnen, diejenige Freihandelslehre über Bord zu werfen, welche sagt, dass das spekulative Privatkapital auf dem freien Markt am besten in der Lage sei, die Warenpreise im volkswirtschaftlichen Sinne zu regulieren. Der gesunde und dauernde Kern dessen aber, was wir als den ökonomischen Liberalismus bezeichnen können, entstammt aus der Zeit vor dem „reinen“ und „bedingungslosen“ Freihandel und lässt sich etwa in folgenden Sätzen zusammenfassen: 1. Auf einer gewissen Stufe der volkswirtschaftlichen Entwickelung muss das Prinzip der wirtschaftlichen Freiheit des Einzelnen, welcher andererseits das Prinzip der Selbstverantwortlichkeit des Einzelnen entspricht, zur allgemeinen Anerkennung gelangen. Danach kann der Staat den Einzelnen nicht ernähren, wenn er sich nicht selbst ernährt, und der Staat kann den Einzelnen nicht bereichern, wenn er sich nicht selbst bereichert.
3. Zu diesen normalen volkswirtschaftlichen Verhältnissen, wie sie sein sollen bezw. erstrebt werden sollen, gehört ein bedeutendes Vorherrschen des Mittelstandes, der Eigentümer seiner Produktionsmittel und wohlhabend genug ist, sich während der Dauer der Produktion selbst zu ernähren. In diesem Falle ist dann das Arbeitsprodukt der naturgemässe Arbeitslohn. Hier bleibt die Bevölkerungsbewegung innerhalb der rechten Proportion zur Nahrungsmittelzunahme. Hier giebt es weder Kapital noch Zins noch Grundrente. 4. Werden diese normalen
volkswirtschaftlichen Verhältnisse durch Ausbreitung
und Herrschaft des Privatkapitals wesentlich
gestört, dann trennt sich
der Mittelstand in Kapitalisten,
Grundbesitzer und 5. Diese kapitalistische volkswirtschaftliche Ordnung ist deshalb für die Gesamtheit so ausserordentlich gefahrvoll, weil dann bei den Proletariern die ausgesprochene Tendenz besteht, über die heimische Nahrungsmittelproduktion immer mehr hinauszuwachsen. Diese Tendenz ist um so gefahrvoller, weil die Herrschaft des spekulativen Privatkapitals zur immer schärferen internationalen Arbeitsteilung neigt und damit das Wohlergehen der eigenen Volkswirtschaft in eine immer bedenklichere Abhängigkeit kommt von dem Wohlverhalten fast aller Länder der Erde. Weil aber in der Welt erfahrungsgemäss tiefere ökonomische Störungen immer wiederkehren, wird dann jedes Mal die eigene Volkswirtschaft von einer entsprechenden einschneidenden Krisis heimgesucht, in welcher die Einzelnen schuldlos und schwer leiden müssen für die Unterlassungssünden des Staates. In solchen kritischen Zeiten durch irgend welche armenrechtlichen Bestimmungen „helfen“ wollen, ist Selbstbetrug, der die Vernichtung der Volkswirtschaft nicht nur nicht aufhalten, sondern nur beschleunigen kann. Hier giebt es nur eine Art der Rettung und das ist: eiligste Rückkehr zu normalen volkswirtschaftlichen Verhältnissen. 6. Der Wert der Arbeitsprodukte bestimmt
sich im Prinzip nach den Produktions- resp.
Reproduktionskosten und ist also gleich dem
„Buchwerte“. Je mehr sich der
Preis der Waren dieser 7. Die beste Steuer ist eine Einkommensteuer mit der Heranziehung des Vermögens und unter besonderer Belastung desjenigen Einkommens, das weder Sorge noch Arbeit gekostet hat. Vorbemerkungen und Litteratur: Der moderne wissenschaftliche Sozialismus wurde durch Karl Marx und Friedrich Engels gemeinsam begründet. Karl Marx wurde am 5. Mai 1818
als Sohn eines jüdischen Advokaten in Trier geboren,
der im Jahre 1824 über Aufforderung der preussischen
Regierung mit seiner Familie zum Protestantismus
übertrat. Karl Marx studierte von 1835 bis 41 in
Bonn und Berlin
Rechtswissenschaften und Philosophie. Seine 1841
beabsichtigte Habilitation in Bonn unterblieb unter
Einfluss ministerieller Massnahmen gegen radikale
Universitätsdozenten. Wurde Journalist.
Gründung der „Rheinischen
Zeitung“ von Jung-Hegelianern im
Einverständnis mit den liberalen Führern
Camphausen und Hansemann als
grosses Oppositionsblatt in Köln. Marx schrieb
über bäuerliche Winzerverhältnisse an der
Mosel und die Gesetzgebung betreffend den Holzdiebstahl.
Wurde im Oktober 1842 Chef - Redakteur der
„Rheinischen Zeitung“. Musste am 1. Januar
1843 Preussen verlassen. Ging nach Paris.
Studium der französischen Sozialisten
(Proud’hon) der politischen Oekonomie
und Geschichte Frankreichs. Sein Uebergang zum
Sozialismus. Wurde Mitarbeiter am
„Vorwärts“, einem kleinen
in Paris erscheinenden Wochenblatte, das
sich hauptsächlich mit dem damaligen deutschen
Absolutismus und Konstitutionalismus kritisch
beschäftigte. Preussen verlangte Marx’
Ausweisung aus Paris. Die französische Regierung
entsprach diesem Verlangen. Marx ging 1845 nach
Brüssel, veröffentlichte hier
seine Streitschrift gegen Proud’hon
„Misère de la philosophie, réponse
à la philosophie de la misère“ 1847.
Im Frühjahr 1847 waren Karl Marx und Friedrich
Engels dem Bunde der Kommunisten, einer geheimen
internationalen Propagandagesellschaft, beigetreten, in
deren Auftrage sie gemeinsam im Januar 1848
„Das Manifest der kommunistischen
Partei“ verfassten. Im Frühjahr 1848
aus Belgien ausgewiesen kommt er nach kurzem Aufenthalt
in Paris im April 1848 wieder nach
Köln, wo vom 1. Juni 1848 ab die
„Neue Rheinische Zeitung“
erschien, die am 19. Mai 1849 zum letzten Male zur
Ausgabe gelangte. Die Redakteure wurden teils verhaftet,
teils landesverwiesen. Wieder nach Paris
gewandert, musste Marx auch hier flüchten, um vom
Juli 1849 ab im Alter von 31 Jahren in
London dauernd Wohnsitz zu nehmen, wo
rastlose Studien in der Bibliothek des britischen Museum
abwechselten mit praktisch-politischer Friedrich Engels, als Sohn eines reichen Fabrikbesitzers in Barmen am 28. November 1820 geboren, verbrachte seine kaufmännische Lehrzeit in einem Zweiggeschäfte seines Vaters in Manchester, beschäftigte sich viel mit philosophischen Studien, traf im September 1844 mit Karl Marx in Paris zusammen, mit dem er sich rasch innigst befreundete. Von 1845 bis 49 lebte Engels mit Marx in Brüssel und Paris und dann in Köln. Er beteiligte sich als Adjutant des Willig’schen Freicorps am badischen Aufstande und flüchtete dann nach England, wo er von 1850 bis 70 im väterlichen Geschäfte in Manchester thätig war, in den letzten 6 Jahren als Associé. Seit 1870 lebte Engels in London, wo er am 6. August 1895 starb. Engels war für Marx nicht nur der treue Mitarbeiter, welcher mit liebevollem Verständnis seinen Intentionen und Ideen gefolgt ist, er entlastete ihn auch vielfach von den Mühen der praktisch-politischen Agitation, ohne dadurch seine Fühlung mit der politischen Praxis zu unterbrechen, und er war endlich der wohlhabende Mann, welcher in selbstloser Weise aus seiner gut gefüllten Börse Hunderttausende zur Verfügung stellte, um auch so das gemeinsame Werk in jeder Weise zu fördern. Von seinen vielen Schriften verdienen besondere Erwähnung: „Die Lage der arbeitenden Klassen in England“, Neudruck Stuttgart 1882. „Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft“, 4. Auflage, Berlin 1891. „Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staates“, 6. Auflage, Stuttgart 1894. Für die Zeitverhältnisse kommen hauptsächlich in Betracht: Engels, „Die Lage der arbeitenden Klassen in England“ und Karl Marx: „Das Kapital“ 1. Band und die in diesen beiden Werken benutzten englischen parlamentarischen Erhebungen. Ueber tendenziöses Zitiren dieser parlamentarischen Enquête bei Marx, vergleiche: Weyer, „Die englische Fabrikinspektion“, Tübingen 1888.
* * *
Noch in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts geschah das Spinnen und Weben der Stoffe auch in England im Hause des Webers. Die Mutter mit den Töchtern spannen das Garn, das der Mann verwebte. Diese Weberfamilien lebten auf dem Lande, in der Nähe einer Stadt. Die Nachfrage nach Stoffen steigerte sich mit der Zunahme der Bevölkerung. Man verkaufte Garn und Gewebe an reisende Agenten und erhielt im Preis der Arbeitsprodukte seinen Arbeitslohn. Die Leute lebten in bescheidenen Verhältnissen zufrieden, hatten zumeist eine kleine Landparzelle gepachtet, um ihren Küchenbedarf selbst zu pflanzen und waren dabei gesund und wohl, wie die Landleute. Da kam — nachdem schon um 1700 Maschinen zum
Spinnen erfunden, aber von der Bevölkerung immer
wieder unterdrückt wurden — um das Jahr 1764
die Einführung der Jenny, welche von
einem Arbeiter mit der Hand getrieben, statt 1 Spindel,
wie das gewöhnliche Spinnrad, Aber mit der Einführung der Jenny hatte die Maschine erst ihren Anfang genommen. Bald begannen einzelne Kapitalisten, Jennys in grossen Gebäuden aufzustellen und durch Wasserkraft zu betreiben. Dann kam im Jahre 1767 die Erfindung des Spinning-Throstle, bei uns Drosselmaschine genannt, die von Anfang an auf eine mechanische Triebkraft berechnet war. Durch Vereinigung der Jenny mit der Drosselmaschine kam 1785 die Mule zu Stande. Und da um dieselbe Zeit die Kardir- und Vorspinnmaschine erfunden wurde, war das Fabriksystem zunächst für das Spinnen der Baumwolle fertig geworden. Die Maschinen für das Spinnen von Wolle, Flachs und Seide folgten. Im Jahre 1804 trat der mechanische Webstuhl in Betrieb, nachdem schon seit 1785 James Watt’s Dampfmaschinen als Triebkraft in den Spinnereien verwendet worden waren. An diese Entwicklung der Fabrikation der
Bekleidungsstoffe schloss sich mit der Ausdehnung des
Maschinenbaues auch die Entwicklung der Eisen- und
Steinkohlen 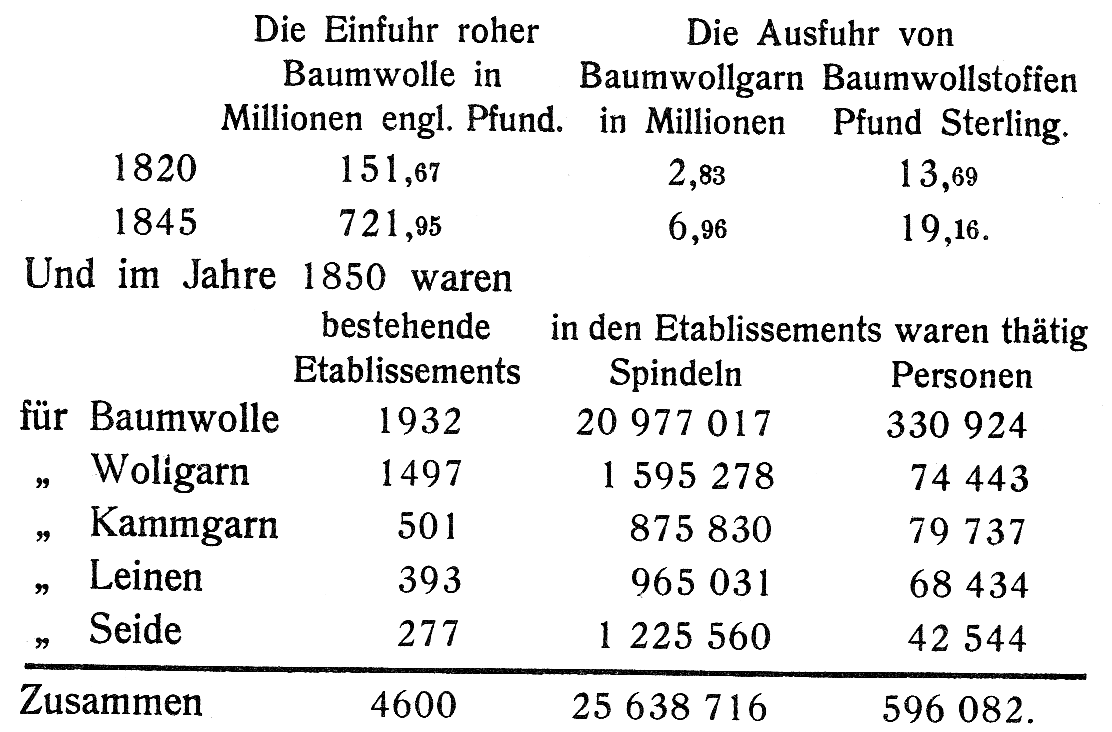 Die Grafschaft Lancashire, der Hauptsitz der Baumwollindustrie, hat ihre Bevölkerung in 80 Jahren verzehnfacht und die beiden Grossstädte Liverpool und Manchester geschaffen. Aehnlich gewaltige Fortschritte verzeichnen die anderen Industrien. An Kohlengruben zählte man in den beiden Grafschaften Northumberland und Durham
1753 . . . . 14
1800 . . . . 40
1836 . . . . 76
1843 . . . . 130
England allein hatte im Jahre 1844 2200 Meilen
Kanäle und 1800 Meilen schiffbare Flüsse. Von
1818 bis 1829 wurden in England und Wales 1000 englische
Meilen Chausseen mit einer Breite von 60 engl. Fuss
gebaut. Dazu das erste englische Dampfschiff seit 1811,
die erste englische Eisenbahn seit 1830. — England
stand mitten Und wie war in dieser Entwicklungsepoche die
Lage der arbeitenden Klasse in England? —
Eine jede maschinelle Erfindung verdrängt Handarbeit
in einem gewissen Umfange, steigert die
Produktionsleistung, setzt die Produktionskosten herab,
ermöglicht den Massenkonsum und steigert dadurch
wieder die Nachfrage nach Arbeitsprodukten und also
schliesslich auch die Nachfrage nach Arbeit. So war durch
die Spinnmaschine die Handspinnerei binnen kurzer Zeit
brotlos geworden, denn es war der Handspinnerin
unmöglich, neben der Maschine sich mit ihrer Arbeit
das Brot zu verdienen. Die Nachfrage nach Handwebern war
allerdings mit der Spinnmaschine wesentlich gewachsen und
dementsprechend ihr Lohn. Mit dem mechanischen Webstuhl
aber wurden auch die Handweber zu Grunde gerichtet. Ihre
Löhne gingen rapid zurück. Bald waren sie froh,
bei 14- bis 18stündiger täglicher Arbeitszeit
nur 10 M. statt wie früher bis 40 M.
wöchentlich zu verdienen. Der Hunger und die Not
trieb allerdings die Mehrzahl dieser Handweber als
Lohnarbeiter in die Fabriken. Aber zum Erlernen
ungewohnter Arbeiten an einer Maschine ist eine gewisse
Jugend erforderlich. Das Alter eignet sich hierzu nicht
mehr; es bleibt am alten Werkzeug hängen, um mit ihm
zu Grunde zu gehen. Diese unheilvollen
Begleiterscheinungen des Prozesses der Verdrängung
von Handarbeit durch die Maschine wiederholten sich mit
jeder maschinellen Verbesserung und Erfindung. Und bis
schliesslich die günstigen Die massenhafte Beschäftigung der Frauen und
Mütter durch 12 bis 13 Stunden pro Tag in der Fabrik
lässt die Kinder wild wie Unkraut aufwachsen.
Deshalb vor Allem die grosse Zahl von
Unglücksfällen gerade in Fabrikdistrikten. Die
Fabrikanten zahlten bei Unglücksfällen
höchstens die Kurkosten. Was sonst aus dem Arbeiter
wurde, war ihnen gleichgültig. Aus Furcht, die
Arbeit zu verlieren, kamen die Frauen oft schon drei bis
vier Tage nach der Niederkunft wieder in die Fabrik. Die
arbeitslos gewordenen Um das in den Gebäuden und Maschinen steckende
Kapital möglichst rentabel zu machen, ging man von
dem möglichst langen Arbeitstag zur Tag- und
Nachtarbeit mit 2 Schichten zu je 12 Stunden
über. Andere Unternehmer liessen viele Arbeiter 30
bis 40 Stunden durcharbeiten. Dazu schlechte Ventilation
in den Fabriken, höchst ungesunde,
überfüllte Massenquartiere, schlechte,
mangelhafte Ernährung, die furchtbaren Wirkungen der
Handelskrisen in den Jahren 1815, 1825, 1836/39, 1847,
1857, welche die Arbeiter zu Hunderttausenden arbeitslos
machten — und das körperliche wie sittliche
Verderben der Arbeitermassen war eine unabwendbare
Konsequenz. Eine lange Reihe von Krankheiten und
Verkrümmungen des Körpers mit Hungertyphus und
Volksseuchen aller Art, erschreckende Zunahme des
Pauperismus und der Trunksucht mit all ihren Folgen
stellten sich ein. Die Lebensdauer der Arbeiter ging
wesentlich zurück. In Liverpool war die
durchschnittliche Lebensdauer der höheren Klasse 35,
der Geschäftsleute und besseren Handwerker 22, der
Arbeiter und Tagelöhner 15 Jahre. Gegen das 40. Jahr
wurden die Arbeiter als „alte Leute“ in der
Regel entlassen. Die Verhaftungen für
Kriminalverbrechen hatten sich in Solch’ entsetzliche Missstände beschäftigten natürlich die öffentliche Meinung von Anfang an. Vom Jahre 1802 ab wurden wiederholt Spezialgesetze zum Schutze der Arbeiter erlassen. Aber all diese gesetzlichen Bestimmungen blieben tote
Buchstaben. Die englische Verknüpfung der
Lokalverwaltung mit dem Fabrikantentum hatte z. B. zur
Folge, dass ein Friedensrichter, welcher einen seiner
Kollegen wegen Verletzungen der
Fabrikarbeitergesetzgebung zur Verantwortung gezogen und
freigesprochen hatte, sich dann auf seine eigne
Rechtsentscheidung stützte, als er nachher seine
Arbeiter in der gleichen Art ungesetzlicherweise
ausbeutete. Die allmächtigen Fabrikbesitzer hatten
das Ohr der Regierung. Alle berühmten Professoren
der Nationalökonomie waren prinzipiell
gegen jede staatliche Einmischung in die
volkswirtschaftlichen Verhältnisse. Dennoch kam nach
vielem Ringen — ohne Mithilfe der
nationalökonomischen Wissenschaft und selbst gegen
ihren Rat — im Jahre 1833 das erste einigermassen
wirksame englische Fabrikgesetz zum Schutz der
Textilarbeiter zu Stande. Bald wussten die Fabrikanten
auch diese Rechtsbestimmungen zu umgehen. Weitere
ergänzende Gesetze wurden deshalb erforderlich. Auch
auf die anderen Industriezweige kamen nach und nach die
gleichen öffentlichen Arbeiterschutzbestimmungen zur
Ausdehnung, nachdem überall fast die gleichen
schreienden Misstände aufgedekt worden waren. Vorher
aber wurden immer wieder nach der englischen
Parlamentssitte besondere öffentliche Enquêten
veranstaltet, in deren umfangreichen Berichten sich all
diese Vorkommnisse gesammelt und niedergelegt finden. In
den Materialien dieser amtlichen englischen Erhebungen
bis 1866 ruht die empirische Unterlage des
„Marxismus“, wobei Karl Marx der Meinung war,
Der sogenannte „utopistische“ Sozialismus vor Marx und Engels hat in ähnlichen Fällen der Ausbeutung und Verelendung — wie sie vorstehend als die Lage der englischen Fabrikarbeiter seit Ausgang des 18. bis Mitte des 19. Jahrhunderts geschildert wurden — seine Aufgabe hauptsächlich darin gefunden, Pläne für eine durchgehende Neugestaltung der Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung zu entwerfen, welche eventuell geeignet wären, solche Missstände künftig auszuschliessen. Vom Standpunkt der Methode lag hier das „Utopische“ hauptsächlich darin, dass man sich ohne jegliche Rücksicht auf das historisch Gewordene, wie auf den historischen Werdeprozess überhaupt, dem konstruktiven Ausmalen der einmal gefassten Reformideen widmete. Was dagegen dem Marx-Engels’schen Sozialismus den Charakter einer „wissenschaftlichen“ Leistung verleiht, ist nicht etwa die Summe und Schönheit ihrer abstrakten Gedankenbilder an sich, sondern lediglich der Umstand, dass Marx bemüht war: die dieser Ausbeutung der englischen Fabrikarbeiter zu Grunde liegenden ökonomischen Gesetze abzuleiten, um dann im Sinne der historisch – volkswirtschaftlichen Entwicklungstendenz die Antwort auf die Frage zu finden, wie diese Missstände durchgreifend beseitigt werden könnten? Der Marx-Engels’sche Gedankengang ist dabei etwa der folgende: Woher stammt der Reichtum der englischen
Fabrikunternehmer? Bei Freihandel ist nicht anzunehmen,
dass Nun ist aber auch bei der Ware „menschliche Arbeit“ der Tauschwert vom Gebrauchswert verschieden, insofern die lebendige Arbeitskraft wesentlich mehr Arbeit leisten kann, als zur Reproduktion erforderlich ist. Wenn z. B. nur die Arbeit von einem halben Tage nötig wäre, um den Arbeiter 24 Stunden zu erhalten, so hindert das den Arbeiter keineswegs, dennoch einen ganzen Tag zu arbeiten. Und weil die menschliche Arbeitskraft diese Fähigkeit hat, mehr Arbeit zu leisten, als sie verbraucht, spricht Karl Marx von einer „Mehrarbeitsleistung des Arbeiters“. Und der Wert dieser Mehrarbeit ist der Marx’sche „Mehrwert“. Diese theoretische Konstruktion auf den Lohnvertrag
angewendet, giebt folgendes Resultat: Der Fabrikarbeiter
verkauft dem Kapitalisten seine Arbeitskraft für
eine gewisse tägliche Geldleistung (Lohn). Nach der
Arbeit von wenigen Stunden ist der Wert des Lohnes
reproduziert. Aber der Arbeitsvertrag bindet den
Arbeiter, noch eine Reihe von Stunden weiter zu arbeiten,
um seinen Arbeitstag voll zu machen. Und der Wert, den er
in diesen zusätzlichen
Diese so auf dem Prinzip der Ausbeutung der Arbeiter
sich aufbauende kapitalistische Produktion trägt den
Keim der Auflösung in sich. Die sicheren Anzeichen
dafür sind die Krisen. Schon der Anfang der
kapitalistischen Produktion charakterisiert sich durch
die Auflösung der bis dahin bestehenden lokalen
Ordnung der Produktion (Zunft). Jetzt sind die
Produzenten ganz selbständig und vereinzelt. An die
Stelle der früheren Organisation ist die
„Anarchie der Produktion“ getreten.
Dafür besitzen wir eine desto straffere
gesellschaftliche Organisation in den einzelnen
Produktions-Etablissements. Die älteren
Produktionsarten, So wird die für die kapitalistische Produktion so wichtige „Reservearmee“ geschaffen, erhalten und fortwährend vermehrt, um damit erst den Arbeiter in ein dem Kapitalisten vollkommen ergebenes Objekt der Ausbeutung zu verwandeln. Die Arbeiterklasse aber sinkt immer tiefer, der Mittelstand verschwindet, die kapitalistische Produktion konzentriert sich in immer grössere Unternehmungen, deren Interessen über den nationalen Markt hinauswachsen, und dem Weltmarkt den internationalen Charakter des kapitalistischen Ringens aufdrücken. Soviel von der Karl Marx’schen
„ökonomischen Gesetzmässigkeit des
kapitalistischen Produktionsprozesses“.
Wohin aber wird diese Entwickelung führen, und wo
findet sich ein Weg zu Gunsten der armen ausgebeuteten
Fabrikarbeiter? Zur Beantwortung dieser Frage hat sich
Karl Marx eine besondere Geschichtsauffassung
konstruiert, die den Namen „materialistische
Geschichtsauffassung“ trägt, und die
sich zu seiner kapitalistischen Produktions–
Schon Ludwig Feuerbach, Saint-Simon, Louis Blanc und Andere hatten die Anschauung vertreten, dass nicht die Ideen die Geschichte beherrschen, sondern dass die Ideen von den Menschen nach Massgabe der Zeitverhältnisse gebildet werden und dass also nicht die Ideen, sondern die realen Verhältnisse das Grundlegende seien im Entwickelungsverlaufe der Geschichte. Karl Marx ging hier noch einen wesentlichen Schritt weiter, indem er den Satz aufstellte: die materiellen Produktivkräfte — also der technische Produktionsprozess — beherrschen die Volksgeschichte. Heute ist die Maschine im Begriff die ganze Ordnung der menschlichen Gesellschaft von Grund aus umzugestalten, und in ganz analoger Weise haben die früheren technischen Fortschritte die geschichtliche Entwicklung regiert. Die sozialen Veränderungen aber, welche damit bezeichnet werden, spielen sich seit Auflösung des uralten Gemeinbesitzes an Grund und Boden immer in einem Gegensatz zwischen der ökonomisch beherrschten und der ökonomisch herrschenden Klasse ab. Sobald neue Produktivkräfte sich entwickelt haben, wird die alte Form der Klassenherrschaft immer unerträglicher, der Klassengegensatz wird zum Klassenkampf und damit ist die soziale Krisis da. Nun sind aber zwei Dinge möglich:
entweder kommt es zur Sprengung der gegenwärtigen
Gesellschaft und Ueberführung in eine höhere
Gesellschaftsform — oder die beiden kämpfenden
Parteien gehen gemeinsam zu Grunde. Die treibende
ökonomische Produktivkraft verursacht also nicht nur
die Leiden und Uebel der Zeit, sie trägt auch das
Heilmittel der Krisis und damit den rechten Weg der
fortschrittlichen Entwickelung in sich. Es ist deshalb
nach Ein wissenschaftliches System, welches — wie der
Marxismus — von dem Grundsatz ausgeht, dass nicht
die Ideen die Geschichte beherrschen, sondern dass die
Menschen nach Massgabe ihrer Zeitverhältnisse die
Ideen bilden, will und muss vor allem mit jenen
historischen Ereignissen betrachtet sein, aus denen
heraus seine Urheber dasselbe abgeleitet haben. Und in
diesem Zusammenhange wird jede Kritik zugeben
müssen, dass die Gewinne der englischen Fabrikanten
in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts sich
in der That recht häufig aus jenem Einkommen
zusammengesetzt haben, welches Karl Marx als Hätten sich Karl Marx und Engels darauf beschränkt, innerhalb dieser engeren Grenzen ihre Ausführungen zu halten, so würden ihre Gegner wenig Berechtigtes einzuwenden haben. Aber Marx und Engels traten mit dem Anspruche hervor, ihr „Mehrwert“ sei die letzte Quelle aller Formen des arbeitslosen Einkommens, welche es bis heute in der Gestalt von Unternehmergewinn, Zins, Grundrente, Handelsprofit u. s. w. gäbe, und ihre Theorien seien die einzig wahren Sätze der Nationalökonomie als Wissenschaft für alle Zeiten und Völker. Indem sie das alles behaupteten, haben sie allerdings den Boden der Berechtigung ihren Lehren entzogen, wie das heute unschwer nachgewiesen werden kann. Zunächst geht der Marxismus von der unrichtigen
Annahme aus, dass alle Kulturvölker dem
Entwickelungsbeispiele Englands folgen
würden, und dass es deshalb genüge, die
englischen Verhältnisse genau zu studieren, um auch
für alle übrigen Völker im Voraus die
rechten nationalökonomischen Theorien aufstellen zu
können. Die heute in Mitteleuropa erwachte Agrar-
und Mittelstandsbewegung bezeugt, dass diese Völker
es entschieden ablehnen, die Bahnen Englands weiter zu
beschreiten. Je mehr sich diese Ideen klären, desto
schärfer Der Marxismus kennt und berücksichtigt ferner unter den Arbeitern nur die Lohnarbeiter und vernachlässigt vollständig die selbständigen Arbeiter, also den Mittelstand im engeren Sinne. Der Marxismus kennt nur die locatio conductio operarum, aber nicht die locatio conductio operis. Er kennt nur das, was die Griechen érgon nicht aber das, was sie apotélesma nannten. Er kennt nur das „Werken“, nicht aber die „planvolle Ausführung eines Werkes“. Er hat sich damit gewissermassen an den „Ausrufer“ gehalten und den „Redner“ ganz ausser Acht gelassen. Der Marxismus kennt ferner all jene Arbeitsberufe nicht, welche sich dauernd an die Gesamtheit anschliessen, deshalb unzweifelhaft volkswirtschaftlich produktiv sind und doch nicht direkt mit dem Produktions- oder Verteilungsprozess der Güter in Verbindung stehen. Wer so weite und wichtige Gebiete der Arbeit unbeachtet lässt, kann unmöglich eine befriedigende Nationalökonomie der Arbeit schreiben. Weiter beschränkt sich der Marxismus in recht
unhistorischer Weise auf das
Produktionskapital und lässt das
Handels- und Leihkapital, wie insbesondere auch das Bank-
und Börsenkapital vollkommen ausser Acht. Die
unmittelbare Folge ist, dass Karl Marx ganz
übersieht, wie häufig auch in der ersten
Hälfte des vorigen Jahrhunderts sich die Gewinne der
englischen Fabrikanten noch aus ganz anderen
Beträgen zusammensetzten, als aus jenen, welche den
Lohnarbeitern „abgeschunden“ wurden. Aus
Der Marxismus ist von der englischen Fabrik
ausgegangen und in ihr stecken geblieben. Die so
hochinteressanten und volkswirtschaftlich äusserst
wichtigen Gegensätze zwischen den Verhältnissen
der Industrie und der Landwirtschaft sind Die von Marx aus einer ganz bestimmten Epoche der englischen Geschichte abgelesene Theorie der Verelendung der Arbeitermassen wurde nach der bahnbrechenden Beweisführung von Julius Wolf in seinem „Sozialismus und kapitalistische Gesellschaftsordnung“ (Stuttgart 1892) auch von den Führern der Sozialdemokratie in Deutschland als heute nicht mehr zutreffend abgelehnt. Aber auch das noch so sehr beliebte Marx’sche Dogma von dem Klassenkampf ist unhaltbar. Zunächst war es eine durchaus unzuverlässig
geprägte Phrase, die französische Revolution
als „Emancipationskampf des dritten Standes“
zu bezeichnen. Die eindringendere Geschichtsbetrachtung
weiss heute, dass es sich in jenen Vorgängen um
wesentlich andere Aufgaben handelte. Das davon
abgeleitete Schlagwort von der „Emanzipation des
vierten Standes“, welches die grosse soziale
Aufgabe der Gegenwart und der nächsten Zukunft
bezeichnen will, hat den Irrtum seines Vorbildes um so
viel mehr vergrössert, als der Begriff der
Lohnarbeit zu klein ist, um sich mit dem
volkswirtschaftlichen Begriff der Arbeit zu decken.
Weiter lehrt uns die Geschichte eines jeden Volkes, dass
es unter normalen, gesunden volkswirtschaftlichen
Verhältnissen keinen Klassenkampf giebt. Die Zeit
der Klassenkämpfe ist die Zeit der sozialen
Krankheiten und Schmerzen. So wenig aber gesagt werden
darf, dass das Leben des Menschen nur mit Schmerzen
ausgefüllt sei, weil jeder einmal krank wird und
Schmerzen haben kann, ebensowenig kann man von der
Geschichte sagen, dass sie nur die Geschichte der
Klassenkämpfe sei. Es ist ferner eine Wir bewegen uns damit bereits auf dem Boden der materialistischen Geschichtsauffassung, mit welcher wir uns jetzt speziell noch beschäftigen wollen. Die vielgerühmte materialistische Geschichtsauffassung ist bis heute immer noch nicht an einer grossen zusammenhängenden Geschichtsdarstellung erprobt und erwiesen worden. Ihre Anhänger würden deshalb gut daran thun, diesen wesentlichen Mangel ihrer Beweisführung endlich einmal nachzuholen. Bis dahin ist man mit Stammler berechtigt, darauf hinzuweisen, dass das Bedürfnis des Sozialismus nach politischem Handeln, das die Entwickelung der Dinge sich keineswegs selbst überlassen will, im scharfen Widerspruch steht mit dem Prinzip der mechanischen Notwendigkeit, das die materialistische Geschichtsauffassung in die historische Bewegung einzuführen bemüht ist.
Der volkswirtschaftliche Körper wird bekanntlich als ein ethischer Organismus betrachtet, für den es gesunde und kranke Verhältnisse, gute und schlechte Entwickelungstendenzen giebt. Wie sollte der rein mechanische Faktor der materiellen Produktivkräfte ohne Kopf und Herz in der Lage sein, in diesen fortwährend uns begegnenden Eventualitäten in der Geschichte den rechten Weg zu wählen? Jede geschichtliche Disposition, welche allen
Thatsachen des Geschehenen gerecht werden will,
kann den Menschen und sein verantwortliches
Handeln nicht entbehren, wobei freilich die
Bedeutung des Einzelnen, selbst im hervorragendsten
Falle, gegenüber der Bedeutung der äusseren
Verhältnisse nicht
überschätzt werden darf. Das hat
vielleicht niemand klarer und treffender ausgesprochen
als der Fürstreichskanzler von Bismarck
in seiner Rede vom 1. April 1896, als er von sich selbst
sagte: „Ich bin eben in einer politisch
günstigen Zeit in Thätigkeit getreten, als ich
die Masse flüssig und zum Gusse fertig fand. Ich
habe gethan, was ich konnte, ohne Menschenfurcht und
Selbstsucht, dass der Guss rascher und sicher erfolgt
ist. Der Staatsmann kann nie selbst etwas schaffen, er
kann nur abwarten und lauschen, bis er den Schritt Gottes
durch die Ereignisse hallen hört, dann vorspringen
und den Zipfel des Mantels fassen — das ist
alles!“ Aber gerade dieses Handeln des Schliesslich bietet ja auch die bisher zur Darstellung
gelangte Entwickelung der nationalökonomischen
Wissenschaft einen guten Einblick in die Natur und
das Wesen der historischen Gestaltung. Als im Mittelalter
die äusseren Verhältnisse sich der Ausbreitung
der Geldwirtschaft neben der Naturalwirtschaft
günstig zeigten, da stellten klug denkende
Männer all jene Mittel und Wege zusammen, durch
welche der Staat diese Weiterentwickelung wesentlich zu
fördern in der Lage war. Als dann mit dem Reichtum,
dem Massenverkehr, der besseren Verkehrs- und
Produktionstechnik die Zeit gekommen war, dem
spekulativen Privatkapital die Oberleitung der
volkswirtschaftlichen Verhältnisse zu
überlassen, da zogen Adam Smith und seine
Schüler die entsprechenden theoretischen
Konsequenzen für Gesetzgebung und Politik,
praktische Staatsmänner verwirklichten diese Ideen,
und erst jetzt konnten sich die Wunder des
kapitalistischen Zeitalters zeigen. Inzwischen wurde in
immer weiteren Kreisen beobachtet, dass der ehrlichen
Arbeit die volkswirtschaftliche Oberleitung durch das
spekulative Privatkapital auf die Dauer so teuer zu
stehen komme, dass die glückliche Weiterentwickelung
der Gesamtheit damit in Frage gezogen So bewähren sich also die Ideen des Marxismus vor einer eindringenden Kritik recht wenig. Dennoch wäre es durchaus unzutreffend, all dieser gewiss schwer wiegenden Beanstandungen halber das Lehrgebäude des Sozialismus kurzweg als einen „wüsten Trümmerhaufen“ zu bezeichnen. Trotzdem auch wir einen Anbau nach dem anderen bei näherer Untersuchung zusammengebrochen finden, bleibt doch noch ein stattlicher Rest des ganzen Gebäudes auf festem Fundamente stehen, der zur Hälfte allerdings schon aus früheren Zeiten stammt, zur anderen Hälfte aber in der That von Marx und Engels gebaut wurde. Und dieser dauernde Kern des sozialistischen Systems lässt sich etwa in folgenden Sätzen zusammenfassen: 1. Die beiden nationalökonomischen Lehrsysteme,
welche auf die meisten europäischen Völker
ihren vollen Einfluss ausüben konnten, sind das
Merkantilsystem und das Freihandelssystem. Das Endziel
dieser beiden Lehrmeinungen ist der Reichtum und zwar
zunächst der Geldreichtum und dann der Reichtum an
wirtschaftlichen Gütern überhaupt. In diesem Zusammenhange bedeutet der Sozialismus den Uebergang aus der Nationalökonomie des Reichtums zur Nationalökonomie der menschlichen Arbeit — „Arbeit“ in jenem vollen Sinne des Wortes, in welchem „arbeiten“ „der Gesamtheit dienen“ heisst. Will man diesen Gegensatz durchaus im Rahmen der Güterwelt bezeichnen, so würde man zu sagen haben, dass es sich um den Uebergang aus einer Nationalökonomie des Reichtums als Besitz in eine Nationalökonomie des Reichtums als jährliches Arbeitseinkommen handelt — auch hier „Arbeit“ im vorbezeichneten vollen Sinne des Wortes verstanden. 2. Dieser Uebergang vollzieht sich nur in Formen, welche den „Kapitalismus“ beseitigen. Zu diesen Formen gehört nicht die Aufhebung des Privateigentums, was von einer Reihe von Sozialisten ausdrücklich bestätigt wird. Die „Beseitigung des Kapitalismus“ bedeutet im Grunde nur die Beseitigung des Wuchers jeglicher Art, welcher die redliche Arbeit in ihrem Einkommen kürzt. Hierzu hat der Marxismus folgende zwei hochwichtige Sätze der Methode gefügt:
4. Die dann zu ergreifenden Reformen aber, welche nicht auf eine blosse momentane Linderung, sondern auf eine vollkommene Heilung des Uebels von innen heraus gerichtet sein müssen, erschliessen sich in ihren leitenden Prinzipien nur für eine Betrachtung, welche den grossen historischen Entwicklungstendenzen mit vollem Verständnis folgt. Als die englische Freihandelslehre begann, auf dem europäischen Kontinent zur allgemeinen Herrschaft zu gelangen und sonst nur noch die Eventualität offen geblieben war, sich dem Sozialismus anzuschliessen, da waren es deutsche Nationalökonomen, welche der Erkenntnis der Wahrheit einen neuen selbständigen Weg öffneten. Friedrich List („Das nationale System der politischen Oekonomie“ 1841, 7. Auflage 1883) bekämpfte erfolgreich das Dogma von der internationalen Arbeitsteilung, welches auf dem besten Wege war, die Alleinherrschaft Englands auf industriellem Gebiete zu begründen. List lehrte, wie jede grössere Nation in der Lage sei, ihren „industriellen Arm“ neben dem agrarischen ebenso wie England zur harmonischen Entwickelung zu bringen und auf welche Weise in Zukunft eine bessere Ordnung der wirtschaftlichen Verhältnisse den grossen Völkern möglich wäre. Rodbertus, Schäffle und Adolph Wagner haben die Lehren des Freihandels wie des Sozialismus einer gleicheindringenden Analyse unterzogen, die Irrtümer auf beiden Seiten aufgedeckt und die Wissenschaft durch neue Theorien und begriffliche Unterscheidungen und durch neue praktisch wertvolle Vorschläge bereichert. Was wir heute durch die Verstaatlichung der Eisenbahnen und die Arbeiter-Versicherungsgesetze gewonnen haben, führt sich zuletzt auf die wissenschaftlichen Arbeiten dieser Männer zurück. Keine Nationalökonomie der Zukunft wird Adolph Wagner’s „Grundlegung der politischen Oekonomie“ (3. Auflage 1892) und Schäffle’s „Kapitalismus und Sozialismus“ (1. Auflage 1870) entbehren können. Besonders anregend wirkten auch die Arbeiten des ideenreichen Lorenz von Stein.
Dieser schon fast unübersehbaren
Speziallitteratur gegenüber machte sich bald das
Bedürfnis nach Zusammenfassung dieser
Materialienfülle immer entschiedener geltend. Ihm
trugen in höchst dankenswerter Weise Rechnung:
Schönberg’s „Handbuch der
politischen Oekonomie“ früher drei, jetzt
fünf Bände, 4. Auflage 1895, das
„Handwörterbuch der
Staatswissenschaften“ von Conrad, Elster,
Lexis und Löning, 2. Auflage
sieben Bände 1901 und Elster’s
„Wörterbuch der Volkswirtschaft“ zwei
Bände 1898. All diese Sammelwerke sind durch das
Zusammenarbeiten einer grossen Zahl von Spezialgelehrten
entstanden, wobei jeder Einzelne seine freie
wissenschaftliche Ueberzeugung ohne Rücksicht auf
die Anschauung seines Nachbarn zum Ausdruck brachte.
Wesentlich ergänzt wird deshalb diese Litteratur
durch Spezialzusammenstellungen einzelner
Forscher wie von Böhm-Bawerk über
„Kapital und Kapitalzins“ 2 Bände
1884/89; Georg Adler, „Geschichte des
Sozialismus und Kommunismus“ 1899, und August
Oncken, „Geschichte der
Nationalökonomie“ 1902.
Georg von Mayr ist
fortlaufend erfolgreich Ein System aber, welches bestrebt wäre, unter Benutzung all dieser Forschungen die Summe der ökonomischen Konsequenzen aus den heutigen Zeitverhältnissen zu ziehen, um so der wirtschaftspolitischen Praxis in ähnlicher Weise vorzuarbeiten, wie das insbesondere Adam Smith und seine Schule für ihre Zeit gethan haben — giebt es heute nicht. Deshalb besteht noch zwischen Theorie und Praxis in der Volkswirtschaft eine höchst bedauerliche Spannung. Die Praxis kommt aus einer nervösen Unruhe mit Novellen auf Novellen nicht heraus. Die Theorie hüllt sich bei vielen wichtigen Fragen in tiefes Schweigen, oder sie ist voller Irrtümer und trägt dann nur zur Verschärfung der politischen Gegensätze bei, statt sie zu mildern und zu versöhnen. Dazu hier folgende Belege: 1. Die seit Jahrzehnten andauernde überwiegende
Beschäftigung mit der Lohnarbeiterfrage und mit dem
Sozialismus hat die grosse Mehrzahl unserer heutigen
Nationalökonomen so sehr in den Gedanken einer
notwendigen Zufriedenstellung der Lohnarbeiter versenkt,
dass man mit äusserster Zähigkeit auch noch die
allgemeine Wittwen- und Waisenversorgung der
Arbeiter mit staatlicher Arbeitslosen
– Versicherung anstrebt. Schon der
Fürstreichskanzler von Bismarck
hat in der Kronratssitzung vom
24. Januar 1890 betont, dass das ein durchaus falscher
Weg der sozialen Reform wäre. Julius
Wolf hat sich das Verdienst erworben, die Bedenken
gegen diese Bemühungen zusammen zu stellen. Wer die
Bedeutung der annona und der collegia in der
römischen Geschichte kennt, den muss bei solchen
wirtschaftspolitischen Bestrebungen Entsetzen 2. Das so schlecht begründete Dogma vom Klassenkampf lässt die unseligen Lohnkämpfe der Arbeiter wissenschaftlich als einen natürlichen Zustand erscheinen, und deshalb waren so viele deutsche Nationalökonomen voll Eifer bei den Gegnern des sog. Arbeitswilligengesetzes. — Man kann gewiss verschiedener Meinung sein darüber, ob eine Handlungsweise bei einem Arbeiter mit Zuchthaus bestraft werden soll, welche von den offiziellen Vertretern der Nationalökonomie als durchaus korrekt und notwendig gelehrt wird. Soviel ist aber gewiss, dass aus dieser Spannung zwischen Theorie und Praxis hervorgeht, wie wenig genügend die nationalökonomische Theorie von der Bildung des Arbeitslohnes ist. 3. Fast überall begegnen wir den bedenklichsten
Forderungen einer grosskapitalistischen
Proletarierpolitik. Der industrielle Export kommt
ins Stocken. Sofort machen sich Bestrebungen geltend zum
Abschluss von noch günstigeren
Handelsverträgen auf Kosten der heimischen
Landwirtschaft, damit noch mehr
Arbeiter in der Exportindustrie Verwendung finden,
von hier aus eine weitere Besserung der
Verhältnisse der Fabrikarbeiter bewirkt wird, die
Proletarierbevölkerung noch
stärker zunimmt und unsere heimischen
volkswirtschaftlichen Verhältnisse noch
mehr von dem Wohlverhalten des Auslandes
abhängig werden. — Gerade die eifrigsten
Vertreter dieser Richtung behaupten, die englische
Geschichte besonders genau zu kennen. Und doch gewinnt
man den Eindruck, als ob sie die Geschichte Englands
während der napoleonischen Kriege niemals gelesen
hätten. Und obgleich die neuesten
Spezialuntersuchungen die Richtigkeit der alten
Malthus’schen Lehre immer 4. Die heutigen Nationalökonomen geben, mit wenigen hervorragenden Ausnahmen, den alten Mittelstand in Stadt und Land auf. Er soll in der modernen Zeit sich nicht halten können. Das schade indess auch wenig. An seine Stelle trete ein neuer Mittelstand, die besseren Angestellten in den grossen Unternehmungen u.s.w. Der Mittelstand wird so zu einem Einkommensteuerbegriff. Marcus Antistius Labeo und Aristoteles waren bekanntlich anderer Meinung. Für sie bestand das Wesen des Mittelstandes in der persönlichen Unabhängigkeit und in seiner Selbstverantwortlichkeit jedem Dritten gegenüber. Zwei Deutsche gehörten vor einigen Jahren als bessere Fabrikangestellte zu diesem neuen Mittelstande und waren in ihren Mussestunden eifrige Agitatoren des radikalen Sozialismus. Inzwischen ist der Eine nach Basel, der Andere nach Zürich gekommen. Dort ist es ihnen gelungen, sich als Gewerbetreibende zu verselbständigen und so in den alten Mittelstand einzutreten. Und siehe da — sofort hatten sie ihr monarchisches Herz entdeckt und wurden im Auslande geschickte Arrangeure der Festkommerse zu Kaisers Geburstag. Sollten nicht auch hier Labeo und Aristoteles der richtigen Anschauung sein? 5. Die deutschen Landwirte klagen über
ungenügende Preise für ihre Produkte. Sie
wollen Preise, welche die landesüblichen
Produktionskosten decken. Das sind nach Quesnay, Adam
Smith, Malthus, Ricardo, Marx und Engels
„normale“ Preise. Eine ganze Reihe unserer
heutigen Nationalökonomen aber stellt sich hier auf
folgenden Standpunkt: Diese Forderung der Landwirte ist
eine Forderung privater Interessen. Würde sie
erfüllt werden, so würde 6. Bevor Minister Buchenberger mit seiner
unvergleichlichen Arbeitskraft in dem ausgezeichneten
„Handbuch der politischen Oekonomie“ von
Adolph Wagner jene Massnahmen
übersichtlich geordnet hatte, welche der Staat zur
Pflege der heimischen Landwirtschaft heute anwendet,
bestanden unsere Universitätsvorlesungen über
7. Der Bericht der deutschen
Börsenenquêtekommission von 1893 enthält
eine wissenschaftliche Einleitung von Gustav
Schmoller, in welcher die Sparkraft des deutschen
Volkes auf 2 bis 2 1⁄2
Milliarden Mark jährlich berechnet wird. Damit
rechtfertigt sich dann vollständig die Grösse
der Emissionen durch die deutschen Fondbörsen. Der
Frankfurter Bankier Cäsar Strauss hat
in der „Kreuzzeitung“ vom 27. und 28. Februar
1895 eingehend nachgewiesen, dass den deutschen
Börsen jährlich nur 450 bis 470 Millionen
Mark als effektive Sparanlage zur Verfügung
stehen. Derselbe Fachmann in Fragen des Geld-,
Börsen- und Aktienwesens hatte schon im Jahre 1892
in seiner Schrift „Unser
Depositengeldersystem und seine Gefahren“
dargelegt, dass die Emissionen der deutschen Börsen
leider die Sparkraft des deutschen Volkes ganz
wesentlich überragen und dass deshalb die
deutschen Emissionsbanken zur Unterbringung ihrer
gewaltigen Ueberemissionen in einer
höchst bedenklichen Weise den Wechselkredit in der
Form des sogenannten
„Gefälligkeitswechsel“
anspannen. Wesentlich aus diesem Grunde hat dann die
Bank von England selbst die Wechsel der
„Deutschen Bank in Berlin“ zu kaufen
abgelehnt. Und wesentlich deshalb finden die
Gründungs- und Emissionsepochen stets in einer
herben allgemeinen Krisis ihren bedauerlichen Abschluss.
Die grosse deutsche Börsenenquête von
1893 ist leider gerade an dieser Kernfrage unseres
modernen Bank- und Börsen 8. In eben diesen „wissenschaftlichen Anlagen“ hat auch eine Abhandlung von Professor Dr. Gustav Cohn Aufnahme gefunden, in welcher ausgeführt wird, dass die Preisnotierungen der Getreideterminbörsen deshalb so grosse Bedeutung hätten, weil sie Landwirte, Händler und Müller über den wahrscheinlichen Verlauf der Preise in der nächsten Zukunft zuverlässig orientieren. In der Wochenschrift „Getreidemarkt“ hatte ich an der Hand der täglichen Marktereignisse wiederholt Gelegenheit, zu zeigen, wie in Zeiten intensiver Spekulation die Spekulanten an den Getreideterminbörsen in ihrem eigenen Interesse gezwungen sind, das Signal der voraussichtlichen Preisbewegung in den Börsenkursen in bewusster Weise falsch einzustellen. Wenn die Baissepartei den Markt beherrscht und die Preise dauernd fallen, dann werden die späteren Termine immer höher notiert, damit die weniger Unterrichteten möglichst viel Ware behalten und so das weitere Herabdrücken der Preise wesentlich erleichtert wird. Wenn die Haussepartei den Markt beherrscht und die Preise fortgesetzt steigen, werden die späteren Termine umgekehrt immer niedriger notiert, damit die schlecht Orientierten ihre Ware verkaufen und dann bei möglichst geringen Warenvorräten die Preise desto leichter weiter gesteigert werden können. U.s.w. u.s.w. Innerhalb des Kreises der studierenden Jugend hat
dieser Zustand unserer nationalökonomischen
Wissenschaft folgende Wirkungen: Gerade die
Intelligenteren fühlen bald heraus, dass die
herrschenden Lehren sie nicht befriedigen „Systeme? Haben wir denn andere? Dass der Marxismus diesen straffen, geschlossenen, einheitlichen Gedankenaufbau darstellt: das möchte ich gerade als seine grösste Bedeutung bezeichnen und dadurch wird er auch auf die Entwickelung der Sozialwissenschaft den dauernsten Einfluss ausüben: dass er uns zwingt zur eigenen Sammlung; dass er uns, wenn unser Geist zu irrlichtelieren beginnt, in die spanischen Stiefel einheitlicher Gedankenentwickelung zwängt. In unserer Zeit der Thatsachenvergötterung, des rückgradlosen Ecclecticismus auf dem Gebiete der Wirtschafts- und Sozialwissenschaft dient uns der Marxismus als mächtige Orientierungs- und Warnungssäule.“ („Zukunft“ 1895 S. 70. ) Je nach Neigung und Veranlagung wird dann von den
Studierenden der Eine Sozialist, der Andere
Pessimist. „Es ist alles verloren
— so heist es dann — Bauernstand,
Landwirtschaft, Mittelstand, nichts kann
gerettet werden. Die Hauptsache bleibt, dass wir
wenigstens die Staats Für unsere Wissenschaft aber folgt daraus die
ernste Pflicht, so bald als möglich ein neues
nationalökonomisches System zu schaffen. Die
einfache Zusammenfassung des bis heute produzierten
Materials giebt noch kein System, wie ja auch ein noch so
grosser Baumaterialhaufen noch kein Haus ist. Wie der
Hausbau von den Bedürfnissen der lebenden Menschen
ausgeht und darnach sein Material zusammenfügt, so
muss auch ein neues nationalökonomisches System in
dem wirtschaftspolitischen Bedürfnis der Gegenwart
seinen Schwerpunkt finden, um darnach das Material der
Spezialforschungen zusammen zu stellen. Die
Missstände im einzelnen sind dabei niemals als
Forderungen einer „Interessenpolitik“
aufzufassen, und die Beseitigung der Missstände ist
nicht als die Aufgabe eines
„Interessenkampfes“ zu betrachten. Alle
Klagen der Einzelnen wollen vielmehr als Symptome
einer spezifischen Erkrankung der Gesamtheit
verstanden sein und das Reformprogramm zur
völligen Beseitigung des Uebels will
aus den grossen Entwickelungstendenzen der
Volksgeschichte auf ihrem Wege aus der
Vergangenheit in die Zukunft abgelesen werden. Bei
dieser schwierigen Untersuchung bietet die Geschichte
jener Völker, welche früher waren, gross
geworden sind und dann zu Grunde gingen, die
allerwichtigsten Anhaltspunkte zur Auffindung der
Wahrheit. Es liegen Die Bewältigung dieser damit bezeichneten Aufgabe geht über die Arbeitskraft eines Einzelnen weit hinaus. Ich habe deshalb nach und nach 48 Mitarbeiter gewonnen, welche vor allem die Materiallieferanten für den Systembau waren und dann die Ueberprüfung der fertigen Konstruktion an der Hand der Quellen zu übernehmen geneigt waren. Ein in der bisher üblichen Weise selbständiges Arbeiten des einzelnen Mitarbeiters war schon darum nicht möglich, weil jeder weitere Abschnitt neue Anregungen für die vorhergehenden Abschnitte lieferte. So wurde mancher Teil mehr als zehnmal total umgearbeitet. Gleichzeitig waren die Umarbeitungen bemüht, die Ausführungen selbst auf den kleinsten Raum zu beschränken. Es sollte dem Leser vor allem die Uebersicht über das Ganze erhalten bleiben. Ursprüngliche Manuscripte von 300 und 400 Seiten sind so nach und nach auf 60 bis 80 Seiten und weniger zusammengerückt. Die Fertigstellung des Ganzen hat sich damit freilich verzögert. Ich glaubte indes im Interesse der Sache diesen Vorwurf ertragen zu sollen. Dafür bin ich auch heute in der Lage, bei der Drucklegung der ersten Zeile zu wissen, wie die letzte Zeile des Systems lauten wird. Aber — selbst all diese Anforderungen
genügen noch nicht für die Schaffung eines
neuen Systems. Es ist vielmehr endlich notwendig,
den rechten konstruktiven Ausgangspunkt zu
finden. Die bisherigen nationalökonomischen Systeme
hatten verschiedene Ausgangspunkte. Das
Merkantilsystem ging vom
Geldreichtum aus, das
physiokratische vom Ich entscheide mich für das Getreide, um hier zunächst diese Wahl zu begründen, bevor wir uns den Studien über die ökonomischen Entwickelungsgesetze der Völker zuwenden, um dann abschliessend das Wesen der sozialen Krankheitserscheinungen der Gegenwart zu ermitteln und das Reformprogramm mit seinen ganz bestimmten Grundbegriffen und Grundprinzipien abzuleiten. *) 1 Quarter englischen Weizen zu 496 Pfund englisch und 1 £ zu 20,40 Mk. gerechnet. |
 |
 |
|
 |
||
| Impressum | Links | |