


| Impressum | Links | |
 |
||
 |
 |
|
Das Getreide als Ausgangspunkt des Systems. |
|
|
Unsere nationalökonomische Litteratur hat bekanntlich damit begonnen, jene Massregeln zusammenzustellen, durch welche eine möglichste Steigerung des Geldreichtums im einzelnen Lande bewirkt werden konnte. Es ist deshalb aus historischen Gründen gewiss verständlich, dass die Nationalökonomen fast bis zur Gegenwart häufig die Erscheinungen und Funktionen des Geldes im Volkskörper der grössten Sorgfalt würdigten und mehr als einmal versprochen haben, durch ausschliesslich geldwirtschaftliche Massnahmen alle Leiden dieser Welt zu heilen. Man wird indes gewiss zugeben, dass das Getreide, das Brot, das weitaus unentbehrlichere für den Menschen ist. Ohne Metallgeld hat die Wirtschaft der Menschen wahrscheinlich Jahrtausende hindurch bestanden. Ohne Getreide ist das Leben der Menschen undenkbar. Wenn also die Wirtschaftslehre überhaupt einseitig aufgebaut werden könnte, so wäre das als Lehre vom Getreide, nicht aber als Lehre vom Gelde möglich. Die heute so oft noch ausschliesslich geldwirtschaftliche Auffassung der politischen Oekonomie gleicht einer Bautechnik, welche die Lehre von den Fundamenten vergessen hat.
Jene gewaltigen historischen Ereignisse, welche wir
mit dem Worte „Völkerwanderungen“
zusammenfassen, waren im Grunde getreidepolitische
Massnahmen. Die historisch – dogmatische
Spezialgeschichtsschreibung hat zwar annehmen zu
müssen geglaubt, dass die germanische
Völkerwanderung nicht aus einem Mangel an
Getreide, sondern aus einem Mangel an
Weideplätzen hervorgegangen sei. Eine
Reihe von höchst wichtigen Gründen zwingen uns
indes, die einschlägigen Stellen bei Strabo,
Cäsar, Tacitus und Plinius
umzudeuten. Die Ernährungsphysiologie lehrt nach
Voigt, dass eine Ernährung des Menschen
mit ausschliesslich animalischer Kost unmöglich sei,
dass aber ganze Völker schon mit Vorteil nur von
Getreidekost gelebt haben, weil das Getreide die zur
Ernährung des Menschen notwendigen Grundstoffe in
der rationellsten Mischung enthält. Die
indogermanische Sprachforschung zeigt, dass das Wort
„Milch“ kein gemeingermanisches Wort ist. Die
neuesten Untersuchungen von Eduard Die Wanderungen der Israeliten, von denen Moses in
seinem ersten Buche erzählt und die sich auf
Abraham, Isaak und Jakob
beziehen, haben ausnahmslos den Mangel an Getreide zur
Veranlassung, und der Zug richtet sich stets nach einer
Gegend „wo Getreide und Wein genug war“. Was
die ältesten römischen Ueberlieferungen uns als
ver sacrum erhalten haben, zeigt uns nach
ungünstigen Erntejahren die Ausrüstung der
Jungmannschaft, die sich in anderen Gegenden eine neue
Heimat suchen. Für die sogenannten
Siebenbürgischen Sachsen in Ungarn ist
es aktenmässig nachgewiesen, dass sie in den beiden
Jahren 1144 und 1151 infolge von Hungers Wie leicht den weniger genau unterrichteten Zeitgenossen diese wandernden Getreidebauern als Viehhirten erscheinen, wird wohl nirgends besser als im 1. Buche Moses 46. Kapitel 1. bis 34. Vers belegt. Jakob wandert in den Zeiten der Teuerung aus Kanaan mit seiner ganzen Familie und mit allem, was sie mitnehmen konnten, nach Aegypten, und Joseph zieht ihnen entgegen, um ihnen zu raten, dass sie zu Pharao sagen, sie und ihre Väter seien immer Viehhirten gewesen — dann würden sie im Lande Gessen wohnen dürfen! Der Segen Isaaks für Jakob aber beginnt mit dem Satze: „Gott gebe dir vom Thau des Himmels und von der Fettigkeit der Erde einen Ueberfluss an Getreide und Wein.“ Die an diese Periode der Getreidepolitik der Wanderungen sich anschliessende Epoche der Politik der Getreideläger kommt mit dem Fortschreiten des Verkehrs und dem immer stärkeren Ueberwiegen der geldwirtschaftlichen Verhältnisse leicht zu Zuständen, in welchen die fundamentale Bedeutung einer richtigen Getreidepolitik verkannt und vergessen wird. Wie hart und empfindlich sich indes eine solche Vernachlässigung der Getreidepolitik bei dem Niedergange der Völker rächt, tritt vielleicht nirgends so scharf uns entgegen, als in der Geschichte des gewaltigen römischen Weltreiches.
Aber nicht nur die römischen Kaiser, auch die
römischen Götter sind dem Getreide
nachgewandert. Ceres gehörte in dem
alten Rom zu den höchsten Gottheiten und wurde
insbesondere verehrt als Beschützerin der Halmfrucht
und der Ehe. Als aber der Getreidebau auf der italischen
Halbinsel mehr und mehr zurückgegangen war,
erscheint auf den gelegentlich geprägten
Denkmünzen auf einmal Ceres nicht mehr allein,
sondern in Begleitung der Göttin
Annona, welche an einem Schiffsvorderteil
lehnt und gewissermassen als Abgesandte der Ceres jene
Getreidemenge repräsentiert, welche von fremden
Ländern über das Meer zur Ergänzung der
heimischen Getreideernten nach Rom zugeführt wurde.
Als aber die überseeischen Getreidezufuhren bald
immer ausschliesslicher das Im Verlaufe der Geschichte eines Volkes bietet
vielleicht nichts so sehr den bezeichnendsten Ausdruck
der auf einander folgenden Ereignisse und der gesamten
kulturellen Entwickelung, als die Bewegungslinie
der Getreidepreise. In der beiliegenden
Kurve finden sich die Weizenpreise in
Strassburg für die letzten 500 Jahre in
Jahresdurchschnitten wie in 31jährigen
Durchschnitten aufgezeichnet. Die 31jährigen
Durchschnitte wurden hier für jedes
Jahr berechnet und dann auf das 16. Jahr der Reihe
eingetragen. Zu Anfang und zu Ende fallen diese
31jährigen Durchschnitte mit den 29jährigen,
27jährigen,
25jährigen . . . . bis
3jährigen Durchschnitten für die letzten drei
Jahre ab. Die der Bewegung der Jahresdurchschnitte in
Fällen ausserordentlicher Zickzackschwankungen
beigegebenen Erläuterungen bezeugen, wie in allen
diesen Fällen in der That jede solche
Zickzackschwankung mit ganz bestimmten einschneidenden
Ereignissen in innigster Verbindung steht. So folgen in
der Reihe dieser Linie als besondere Ereignisse die
Hugenottenkriege, der dreissigjährige Krieg, die
Eroberungskriege Ludwigs XIV., der pfälzische
Erbschaftskrieg, der spanische Es darf deshalb gesagt werden, dass das Getreide die wichtigste Güterkategorie der menschlichen Wirtschaft ist. (Vergleiche das ausführliche Referat unseres Mitarbeiters Dr. Armin Tille „Getreide und Geld“ in Conrad’s Jahrbüchern für Nationalökonomie und Statistik Band 20, 1900. S. 721 bis 754.) Wie die Produktion früher ist als der Verkehr, so
ist das Getreide früher als das Geld. Weil aber auch
in der Epoche vor der Einführung des Geldes für
mancherlei Zwecke ein Zahlungsbedürfnis besteht, so
werden die vorhandenen und leichter entbehrlichen
Güter in eine allgemein anerkannte Wertscala
eingereiht, die uns für die früheste Zeit der
germanischen Geschichte namentlich durch die
Bussgeldbestimmungen der alten Volksrechte
überliefert worden ist. So ist z. B. nach der
lex Ripuaria aus dem 7. Jahrhundert Titel
36, 11 und 12 das Wehrgeld eines freien Ripuariers gleich
200 Schilling. Und diese 200 Schilling werden „gut
gemacht“ mit 20 Kühen, 1 Stier, 10 Hengsten, 1
wilden Habicht, 1 Schwert ohne Scheide und 1 Brünne.
Die keltisch-irische Wertscala setzt 1
Sclavin gleich 3 Unzen Silber, 1 volljährige Kuh
gleich 1 Unze Silber, 1 junge Kuh mit 3 Jahren gleich
1⁄2 Unze Silber gleich 12
screapalls (scripulus) und 1 Jährling gleich 4
screapalls. In beiden Fällen ist Edelmetall und Geld
in der Wertscala genannt. Aber es wäre irrig,
anzunehmen, dass die Ripuarier und Kelten sich des
Silbers und des Schillings als Zahlungsmittel bedient
hätten. Nein, Ripuarier wie Kelten zahlten mit
Sclaven, Kühen, Stieren, Hengsten u.s.w. Das Getreide fehlt noch, aber nicht
deshalb, weil Ripuarier und Kelten es nicht gekannt
hätten, sondern weil die Getreideproduktion kaum
regelmässig über den eigenen unmittelbaren
Bedarf hinausreichte. Das wird mit der Dauer der
Besiedelung des Landes und mit der fortschreitenden
Bebauung desselben anders. Das Capitulare
Saxonicum vom 8. Jahrhundert und die lex
Saxonum führen bereits Hafer und Roggen an.
In einer St. Galler Urkunde Aber auch dort, wo das Edelmetall beginnt, seine
Funktion als Geld anzutreten, steht vielfach das Getreide
als Vermittlerin dieser Funktion für Gold und
Silber. Nach Man ersieht aus all dem, in welch gewaltigem Umfange die ganze formelle Ordnung unseres Metallgeldes auf dem Getreide ruht. (Vergleiche hierzu insbesondere das ausgezeichnete Referat von Prof. Dr. August Oncken „Was sagt die Nationalökonomie als Wissenschaft über die Bedeutung hoher und niedriger Getreidepreise?“ 1901.) Wenn das Getreide in der That eine so hervorragende Rolle in dem Leben der Völker spielt, dann kann seine Bedeutung hier unmöglich zum ersten Male ausgesprochen sein. Vielmehr müssen sich gerade in der besten nationalökonomischen Litteratur eine Reihe von Aeusserungen der gleichen Art finden, was die Spezialforschung vollkommen bestätigt hat. Aus der merkantilistischen Litteratur sind es
insbesondere: W. Stafford (1581), A.
Montchrétien de Vatteville (1615), Véron de
Forbonnais (1754), welche auf die ausschlaggebende
Bedeutung der Getreidepreisbewegung für die
volkswirtschaftliche Entwickelung nachdrücklichst
verweisen. Der Stifter des physiokratischen Systems
François Quesnay hat seiner im Jahre
1766 veröffentlichten grundlegenden „Analyse
du Tableau Economique“ einen durch
Xenophon dem Socrates in den
Mund gelegten Ausspruch als Motto vorangestellt, welcher
lautet: „Wenn der Ackerbau gedeiht, so gedeihen mit
ihm alle anderen Künste, geht er aber zurück,
so verfallen mit ihm auch alle anderen Erwerbszweige, sei
es zu Lande, sei es zu Wasser.“ Das Gedeihen des
Ackerbaus ist nach Quesnay aber von guten
Getreidepreisen, welche dem Landwirt einen reichlichen
Gewinn lassen, unzertrennlich. Der berühmte
Vorläufer von Adam Smith Josiah Tucker
(1711 bis 1799) hat schon sein Gesetz normaler
volkswirtschaftlicher Entwickelung dahin formuliert, dass
mit dem Steigen der Kultur „die
Bodenproduckte im engeren Sinne
teurer, die Kapitals- und
Arbeitsprodukte aber wohlfeiler
werden“. Adam Smith hat Die gleiche Anschauung hat bekanntlich auch
Fürst Bismarck schon am 21. Mai 1879 im
deutschen Reichstag mit folgenden Worten vertreten:
„Wir alle erinnern uns, dass vor 12 und 20 Jahren
die Kornpreise sehr viel höher waren als heute, und
dass dennoch damals in allen Die Wirklichkeit bestätigt diese Auffassung überall. Im Innern der Kornkammer von Indien z. B. kostet eine Tonne Weizen durchschnittlich 22 bis 26 Mark. Im Innern der Kornkammer von Russland erhöht sich dieser Preis etwa auf 30 Mark. Ein Durchschnittspreis für die Tonne Weizen im Innern von Argentinien darf auf 70 bis 80 Mark angegeben werden. Die Farmer des Westens in Nordamerika behaupten, erst bei einem Preise von 150 Mark per Tonne Weizen ökonomisch gesichert zu sein. Und als normale Weizenpreise für Berlin berechnen sich rund 200 Mark per Tonne. Spezial-statistische Untersuchungen der neueren und
neuesten Zeit beschäftigen sich mit dem
Einfluss der Getreidepreise auf die
Arbeitslöhne, auf die Preise der
wichtigsten Lebensmittel anderer Art, auf die
Bevölkerungsbewegung Die täglichen Beobachtungen der
Preisveränderungen auf den wichtigsten Getreide- und
Fleischmärkten der Erde haben
besonders im Winter und Frühjahr 1901/1902 die
innige Wechselbeziehung der Preise für die
verschiedenen Getreidearten unter einander wie Weizen,
Mais, Hafer, Gerste und Roggen, wie auch die
Wechselbeziehung zwischen den Preisen für diese
Getreidearten einerseits und für Schweinefleisch und
Schweinefleischprodukte andererseits besonders scharf
hervortreten lassen. So wurde z. B. in den
Börsentelegrammen aus Nordamerika im Monat März
1902 an 25 Markttagen 22 mal die Erklärung der
Preisveränderungen für eine der
Hauptgetreidearten oder für die Fleischwaren
ausdrücklich auf analoge Preisveränderungen der
anderen Getreidearten bez. der Fleischwaren
zurückgeführt. Infolge der Missernte in Mais im
Herbst 1901 und der deshalb hohen Maispreise wurden nach
Auffassung der besten Sachverständigen Nordamerikas
50 bis 100 Millionen Bushels Weizen an Stelle des Mais in
die Viehställe der nordamerikanischen Farmer zur
Verfütterung an das Vieh gedrängt. Im
Leitercorner-Jahr 1897/98 wurden bei hohen Weizenpreisen
und billigen Maispreisen ganz ausserordentlich grosse
Maismehlmengen zur Vermischung mit Weizenmehl verwendet.
Sind die Roggenpreise unverhältnismässig
billiger als die Weizenpreise, so versteht es die moderne
Mühlentechnik, eine Spezialmarke von Roggenmehl
herzustellen, welche zur Mischung mit Weizenmehl bei
Herstellung von Weissbrot anstandslos verwendet werden
kann. Sind umgekehrt die Roggenpreise
unverhältnismässig höher als die
Weizenpreise, so wird eine dementsprechend grössere
Mischung des Roggenmehls mit dem Weizenmehl für
Roggenbrot vorgenommen. Dass hohe Um auch dem Auge die Bestätigung dieser Ausführungen zu bieten, verweisen wir auf die Kurve auf Seite 184 und 185 welche von Januar 1900 bis Januar 1902 die Parallelbewegung zwischen den Maispreisen in New-York, den Schweineschmalzpreisen in New-York und den Preisen für lebende Schweine in Mannheim, Dresden und Berlin veranschaulicht, Die Klassiker der deutschen landwirtschaftlichen Litteratur: Albrecht Thaer, Alb. Block und Koppe haben alle landwirtschaftlichen Wertschätzungen und Berechnungen nicht nach Geldwerten, sondern nach Roggenwerten vorgenommen, weil Roggen in der Heimat dieser Schriftsteller die wichtigste Getreideart ist. Und heute noch setzt Prof. Dr. Theod. Frhr. von der Goltz in seiner landwirtschaftlichen Taxationslehre neben jede Geldwertziffer die entsprechende Roggenwertziffer ein, um damit seiner Ueberzeugung Ausdruck zu verleihen, dass das Getreide der eigentliche Normalmasstab für volkswirtschaftliche Vorgänge sei. Es ist eine bekannte Taktik der heutigen Freihändler, die organische und prinzipielle Bedeutung des Getreidebaus möglichst ausser Acht zu lassen und die Klagen über zu niedrige Getreidepreise als solche zu bezeichnen, welche durch Uebergang vom Getreidebau zur Viehzucht und zum Handelsgewächsebau von den Landwirten selbst am besten beseitigt werden könnten. Namentlich Lujo Brentano und seine Schule haben die Vertretung auch dieser Auffassung mit besonderem Eifer übernommen und verschiedentlich behauptet, dass Deutschland aus einer Reihe von Gründen seinen eigenen Brotgetreidebedarf gar nicht bauen sollte. Die Gefahr einer Hungersnot sei dabei um deswillen nicht in Rechnung zu ziehen, weil im Bedarfsfalle eine chemisch-technische Herstellung des Brotes mit Umgehung der landwirtschaftlichen Produktion kaum lange auf sich warten liesse. Es handelt sich anscheinend hier um ein sicheres Inaussichtstellen der rein technischen Lösung jenes alten, bis heute noch nicht vollbrachten Wunders, aus Stein Brot zu machen. Wir wollen auf nächster Seite diesen theoretischen Erwägungen gegenüber zunächst die Ziffern der Anbaustatistik für die grössten Kulturländer anführen, um die Flächen, welche heute mit Getreide, Hackfrüchten und Handelsgewächsen bestellt sind, kennen zu lernen. Mit der einzigen Ausnahme von England, das bekanntlich seinen Getreidebau dem Handel und der Industrie geopfert hat, nehmen also Getreide und Hülsenfrüchte zwischen 60 und 78% der gesamten Anbaufläche ein. Nach diesen Ziffern kann mithin kein Zweifel darüber bestehen, dass der Getreidebau der weitaus wichtigste Teil der landwirtschaftlichen Produktion ist. 
Eine ausdrückliche Bestätigung findet diese Auffassung für Deutschland z. B. durch die Erfahrungen des Jahres 1893. Die Dürre dieses Jahres hat vom 1. Dezember 1893 den Rindviehstand überhaupt um 6,7%, die Tiere bis zu zwei Jahre alt um 17,1%, jene mit zwei und mehr Jahren um 1,3% abnehmen lassen. Diese Jungviehabnahme erreichte im Schwarzwaldbezirk Württembergs die Höhe von 36%. Man wird angesichts solcher Ziffern kaum sagen können, dass die deutsche Rindviehhaltung jene Grenze noch nicht erreicht hätte, welche ihr durch die natürlichen Verhältnisse gezogen werde. Aehnliche Vorgänge konnten im Jahre 1889/90 in
den Vereinigten Staaten von Nordamerika
beobachtet werden. Im Verlaufe der 80er Jahre war man
sehr energisch bemüht, die Viehbestände zu
vermehren. Unter der damit stark wachsenden Nachfrage
nach Zuchtvieh ist der Preis für einheimisches Vieh
pro 100 Pfund englisch von 18,48 M. im Jahre 1878 auf
26,25 M. im Jahre 1882 gestiegen. Die nordamerikanische
Viehzählungsstatistik, welche leider nur für
die Jahre 1870, 1880, 1890 und 1900 vorliegt, zeigt
für die sechs grossen getreidebauenden Staaten
Indiana, Illinois, Jowa, Missouri, Kansas und Nebraska
von 1870/90 immer noch eine Zunahme der
Rindviehbestände von 3'252'000 auf 12'467'000 und
für die Weidestaaten des Westens ein Anwachsen von
drei auf acht Millionen. In diese damit bezeichnete
Entwickelung kam durch harte Winter und trockene Sommer
eine Krisis, deren Höhepunkt in das Jahr 1889 fiel,
in welchem die Die Verlegung des Schwerpunktes der
landwirtschaftlichen Produktion auf die Viehzucht hat in
der Regel ein Hindrängen zur Frühreife mit
starkem Abmelken der Kühe zur Folge. Damit
erhöht sich erfahrungsgemäss sehr wesentlich
die Empfänglichkeit der Tiere gegen Seuchen und
Krankheiten aller Art. Eben diese Seuchen haben dann eine
plötzlich eintretende Grenzsperre zur Folge, durch
welche die heimische Landwirtschaft um so schwerer
geschädigt wird, je mehr sie sich auf den Export
ihrer viehwirtschaftlichen Produkte eingerichtet hatte.
Einen beachtenswerten Beleg hierzu bietet uns
Dänemark. Die der Viehzucht
günstigen Verhältnisse haben es mit sich
gebracht, dass die dänische Landwirtschaft schon vor
dem Jahre 1878 eine recht bedeutende Mehrausfuhr an
lebenden Tieren hatte. Dieselbe ist in den Jahren 1882
und 1883 auf 564'589 Stück gestiegen, um dann
plötzlich in den Jahren 1885 und 1888 auf 294'662
und 127'170 und bis 1896 sogar auf 81'505 Stück
herabzusinken. Tierseuchen hatten Grenzsperren von Seiten
des Auslandes veranlasst. Von Zeit zu Zeit kehrten diese
Grenzsperren wieder. Die dänische Regierung selbst
schloss ihre Grenzen für die Ausfuhr von lebendem
Vieh, um dergleichen Massregeln von Seiten des Auslandes
zuvorzukommen. Die Ausfuhr von lebendem Vieh kam durch
diese Massregeln in eine Krisis, welche dahin
drängte, an Stelle der lebenden Tiere tierische
Produkte auf die fremden Märkte zu bringen. Damit
ist die dänische Landwirtschaft in Abhängigkeit
zu dem exportierenden Schlachtgewerbe getreten, das je
nach der Gestaltung seiner Organisation — wie
insbesondere auch wieder die neuesten Erfahrungen in
Nordamerika Im übrigen darf als bekannt vorausgesetzt werden, dass eine Zunahme in der Zahl der Viehbestände und in der Intensität der tierischen Produktion keineswegs etwa eine entsprechende Einschränkung des Getreidebaues zu Gunsten einer Zunahme der Weideflächen und Futterflächen zur notwendigen Voraussetzung hat. So ist in den Vereinigten Staaten der Getreidebau nicht zurückgegangen, obwohl uns die Viehstatistik eine steigende Entwickelung zeigt. Und ebenso stieg in Deutschland die Zahl von
1873 bis 1900
bei Pferden von 3 352 231 auf 4 195 261 Stück
" Rindvieh " 15 776 702 " 18 939 692 "
" Schweinen " 7 124 088 " 16 807 014 "
Zugleich betrugen die Nutzungsprozente der verschiedenen Kulturarten:
1883 1893 1900
Getreide und Hülsenfrüchte 60,1 60,9 61,0 %
Hackfrüchte 15,1 16,2 17,5 %
Futterkräuter 9,2 9,6 10,1 %
Handelsgewächse 1,3 1,0 0,7 %
Die Zunahme der Viehhaltung beruht also wesentlich auf intensiverer Kultur bei annähernd gleicher Nutzungsfläche.
„Krapp“ heisst die in der Färberei
früher in grossem Massstabe gebrauchte Wurzel der
Färberröte (Rubia tinctorum), deren wichtigster
Farbstoff das Alizarin ist. Schon Karl der Grosse soll
den Krappbau in Frankreich eingeführt haben. Er kam
insbesondere im 16. Jahrhundert in Deutschland und zwar
im Elsass, in Baden und in der bayerischen Pfalz und dann
auch in Holland zur Ausbreitung und taucht im 18.
Jahrhundert wieder in Frankreich auf, wo er sich in dem
lockeren sandigen Boden der Departements Vaucluse 1) Da gelang es in diesem Jahre 1868 den Chemikern
Karl Graebe und Karl Liebermann in
Berlin,
1870 . . . 13 bis 14 Mark
1882 . . . 5,55 "
1888 . . . 1,70 "
1902 . . . 1,30 "
Der Preis für 50 Kilo getrocknete Krappwurzeln ist von 40 Mark auf 6 bis 8 Mark zurückgegangen. Der Krappbau ist deshalb heute fast vollständig verschwunden. Die früher mit Krapp bestellten Aecker aber tragen heute zumeist wieder Getreide. Waid (Isatis tinctoria) zum Blaufärben verwendet, wurde in Frankreich, Elsass, England und namentlich in Thüringen in ausgedehntem Masse angebaut. Die schon im 8. Jahrhundert berühmten fünf Waidstädte: Erfurt, Gotha, Langensalza, Tennstedt und Arnstadt hatten das Privileg, Waid zu bauen. Die Waidbauern wurden wegen ihrer grossen Wohlhabenheit „Waidjunker“ genannt. Da begann um die Mitte des 16. Jahrhunderts die
holländisch-ostindische Compagnie ostindische
Indigopflanzen nach Europa einzuführen, welche den
Indigofarbstoff des Waid in grösseren Mengen
enthalten. Den „Waidjunkern“ erwuchs daraus
eine höchst gefährliche Konkurrenz. Ihre
Interessen suchte man zu schützen durch eine Reihe
von staatlichen Massnahmen, mit deren Anwendung die
Königin Elisabeth von England begonnen
hat. Hohe Schutzzölle und absolute Einfuhrverbote
wurden Aber auch die Tage des amerikanischen und indischen Indigobaues sind gezählt. Im Jahre 1880 entdeckte der Münchener Professor A. Bayer die künstliche Darstellung des Indigoblau aus dem Steinkohlentheer. Seit Sommer 1897 kommt künstliches Indigo in den Handel. Die Preise für indisches Indigo fielen von 27 M. pro Kilo im September 1868 auf 12 M. pro Kilo im September 1900. Die weitere Entwickelung dieser Konkurrenz wird also kaum anders verlaufen, als die Konkurrenz zwischen Alizarin und Krappbau verlaufen ist. Der Flachs, auch Lein genannt (Linum usitatissimum) war als Kulturpflanze den Aegyptern in sehr früher Zeit bekannt. Es ist die älteste Handelspflanze Deutschlands. Schon zur Römerzeit wurde deutsche Leinewand nach Rom exportiert. Und vor dem 30jährigen Kriege war Deutschland das erste Land des Flachsbaues und der Leinenproduktion. Noch zu Anfang des 19. Jahrhunderts waren verschiedene Marken deutscher Leinen beliebte Handelsartikel. Da kam die Erfindung der Baumwollspinnerei und
Weberei. Billige Baumwollstoffe und billiges Garn, in
1878 1883 1893 1900
0,51 % 0,41 % 0,23 % 0,20 %
des Acker- und Gartenlandes. In
Nordamerika, wo sich natürlich die gleichen
Verschiebungen geltend machen, giebt man den Flachsbau
zur Fasergewinnung auf, um sich auf die
Leinsamengewinnung zu beschränken. Das Leinöl
ist
Leinsamen in Bushels Flachsfaser in Pfund englisch
zu 36,35 Ltr. zu 0,45 kg
1845 562 312 7 709 676
1859 566 867 4 720 145
1879 7 170 951 1 565 546
1889 10 250 410 241 389
1901 26 170 000 50 000
Wie mit dem Flachsbau, so steht es auch mit dem Hanfbau. Nach der deutschen Anbaustatistik waren mit Hanf bestellt
1878 1883 1893
0,08 % 0,06 % 0,03 %
der gesamten Ackerfläche. Die Hanfpreise sind in Hamburg von 92 M. auf 28 M. bezw. 36 M. im Jahre 1894 und 1897 pro Metercentner gesunken, dann unter dem Einfluss einer schlechten Ernte im Jahre 1900 auf 63 M. gestiegen, um seitdem von Neuem wieder abzuflauen. Der Hopfen (Humulus), allen Völkern nördlich
des Himalaya bekannt, ist auch in Europa heimisch und
zwar besonders in Deutschland, England und Schweden. Als
Bierwürze soll er erst seit den Kreuzzügen
verwendet und angebaut worden sein. Die Heimat der
berühmtesten Hopfenqualität ist
Böhmen und zwar das Gebiet der Stadt
Saatz. Von hier aus wurde anfangs des 14.
Jahrhunderts der Hopfen nach Bayern und zwar
speziell nach Spalt eingeführt, wo er
bald so viel Berühmtheit
in Bayern . . . . . . 26 233 Hektar
in Deutschland . . . . . 42 073 "
in Oesterreich-Ungarn . . . 16 099 "
in Frankreich . . . . . 4 081 "
in Belgien und Holland . . . 4 380 "
in Russland . . . . . . 3 800 "
in England . . . . . . 33 290 "
in Amerika . . . . . . 20 335 "
in Australien . . . . . 800 "
--------------
Zusammen auf der ganzen Erde 125 058 Hektar.
Die ökonomische Lage der
Hopfenbauern ist heute aber höchst bedauernswert. In
Deutschland ist von 1895 zu 1900 bereits ein
stetiger Rückgang des Hopfenanbaues
eingetreten um jährlich ca. 1000 Hektar bis auf
37'191 Hektar in 1900. Die Ernteerträge schwanken
1828 niedrigster Preis 20 Mark
1829 höchster " 720 "
1850 niedrigster " 150 "
1851 höchster " 750 "
1859 niedrigster " 380 "
1869 höchster " 1070 "
1875/76 niedrigster " 270 "
1876/77 höchster " 1240 "
1893/94 höchster " 700 "
1894/95 niedrigster " 200 "
Die Einfuhr - Handelspreise betrugen nach der amtlichen Reichshandelsstatistik
im Jahre 1898 400 Mark per Dz.
" 1901 170 " "
Die Hopfenproduktion ist also einem Lotteriespiele vergleichbar, bei dem jetzt die gewohnten Treffer ausbleiben. Eigentlich ist der Hopfenbau nur in solchen Wirtschaften am Platze, die auch ohne diesen Handelsgewächsbau gesichert sind. Sehr zutreffend schildert diese Situation das bayerische Bauernsprichwort:
Die Gründe aber für diese veränderte
Bewegung der Hopfenpreise sind leicht anzugeben. Der
Rückgang der Getreidepreise hatte international auch
zu einer Ausdehnung des Hopfenbaues und damit zur
Ueberproduktion von Hopfen Der Tabak (Nicotiana) wurde nach der Entdeckung
Amerikas von Spanien und England nach Frankreich,
Deutschland, Italien u.s.w.
eingeführt. Die Tabakblätter wurden in
Frankreich zunächst allgemeiner als Schnupftabak
Geeignet ist der Tabakbau in Mitteleuropa heute fast
nur für den Kleingrundbesitzer, der die
Arbeitskräfte fast aller Familienglieder von den
Kindern bis zum Grossvater dabei in passender Weise
verwendet. Wo Lohnarbeiter in Betracht kommen, steigen
die Produktionskosten so ausserordentlich, dass jede
Rentabilität ausgeschlossen erscheint. Nach der
deutschen Enquête von 1878 schwanken aus diesem
Grunde die Produktionskosten pro Hectar von 384 bis 1768
Mark, während der Rohertrag pro Hectar nur 700 bis
800 Mark erreichte. Die Rentabilität des Tabakbaues
war deshalb in der Hälfte aller untersuchten
Betriebe schlecht. Je nach der Qualität schwanken
die Tabakspreise ausserordentlich. Von der 1891er Ernte
z. B. wurden in der Pfalz 6 bis 52 Mark, in Baden 9 bis
49 Mark, in Brandenburg 14 bis 66 Mark pro 100 kg ohne
Steuern Die Einfuhr ausländischer Tabake nimmt fortwährend zu. Gleichzeitig wächst die Verwendung von Tabaksurrogaten, von denen die Reichssteuereinnahme von 20'000 Mk. in den Jahren 1881/86 auf 55'000 Mk. im Jahre 1900 gestiegen ist. Eine nennenswerte Wieder-Ausdehnung des Tabakbaues scheint deshalb für Deutschland ausgeschlossen. Raps (Brassica napus) und Rübsen (Brassica rapa) sind seit alter Zeit in Mitteleuropa die wichtigsten Oelfrüchte. Insbesondere der Raps wurde in den 50er Jahren unseres Jahrhunders in ausgedehntem Masse als „cash crop“ (Geldfrucht) zur Bezahlung grösserer Forderungen an bestimmten Terminen auf grösseren, mittleren und kleineren Gütern angebaut, trotzdem das Wetter wie auch Krankheiten und tierische Feinde den Ertrag leicht gefährdeten. Raps- und Rüböl wurde hauptsächlich als Brennöl, dann auch als Schmieröl und zur Seifensiederei und endlich von der ärmeren Bevölkerung öfter als Speiseöl verwendet. Durch die Einführung von Petroleum,
Gas und elektrischem Lichte ist
das Rüböl von der Verwendung zu Leuchtzwecken
fast völlig verdrängt worden. Der Branntwein wurde ursprünglich nur in kleinen
Mengen als Heilmittel aus Wein hergestellt. In
grösseren Mengen wurde er zuerst von den
südspanischen Arabern erzeugt, welche darin die
Lehrmeister der Italiener wurden, die den Branntwein im
14. Jahrhundert als Handelsartikel über die Alpen
brachten. Wahrscheinlich ist im 15. Jahrhundert die
Bereitung des Branntweins aus Getreide aufgekommen. Seine
Herstellung aus der Kartoffel (Solanum tuberosum) wird
zuerst 1682 erwähnt, nachdem diese Pflanze um die
Mitte des 16. Jahrhunderts aus Peru nach
Europa eingeführt worden war. Die erste
Kartoffelbrennerei soll 1750 zu Monsheim in der
Pfalz errichtet worden sein. Bis etwa zum Jahre
1840 war die Branntweinbrennerei vorzugsweise ein
städtisches Gewerbe, das beinahe ausschliesslich
Getreide verarbeitete. Mit dem immer mehr Speziell in Deutschland waren 1887/88 6268
Kartoffelbrennereien, welche 2'009'416 Tonnen Kartoffeln
verarbeiteten. Im Betriebsjahre 1896/97 wurden nur noch
5571 Kartoffelbrennereien betrieben, die zusammen
2'116'139 Tonnen Kartoffeln verbrauchten. Inzwischen ist
bis 1900 die Zahl der Kartoffelbrennereien wieder auf
6334 mit 2'502'000 Tonnen Kartoffelverarbeitung
gestiegen. Aber da der Spiritusverbrauch mit dieser
Vermehrung nicht gleichen Schritt hielt, so steht das
Gewerbe gegenwärtig vor einer Kalamität, die zu
einer intensiven, auf
Produktionsbeschränkung gerichteten
Bewegung Die Zahl der Getreidebrennereien ist von 5677 in 1891 auf 8688 in 1900 gestiegen, dagegen der Getreideverbrauch von 491'000 auf 364'000 Tonnen gesunken. Hier hat also der Zuwachs in der Zahl der Betriebe den durchschnittlichen Umfang derselben verkleinert. In der Schweiz hat man durch das Gesetz vom 23. Dezember 1886 1443 kleine und 7 Grossbrennereien aufgehoben und nur Betriebe mit einer Jahresproduktion von 150 bis 1000 hl beibehalten oder neu zugelassen. In England, dem Lande der Grossbetriebe, erreicht die jährliche Durchschnittsproduktion der Brennereien nach Jul. Wolf 25'000 bis 30'000 hl und die grösste sogar über 80'000 hl. Trotz der ungünstigen Preislage des Branntweins bei fortwährendem Rückgange der Ausfuhrziffer hat sich die gesamte Jahresproduktion in Deutschland seit 1888 auf über 4 Millionen Hectoliter gesteigert. Man versuchte den Ausfuhrverlust durch die Steigerung des Verbrauchs für gewerbliche Zwecke auszugleichen, was aber bisher nicht in dem erforderlichen vollen Masse gelungen ist. Aber wenn auch nach dieser Richtung noch wesentliche Fortschritte zu erwarten sind, so könnte damit doch höchstens für den gegenwärtigen Produktionsumfang ein gesicherter Absatz geschaffen werden; für eine künftig etwa noch weitere Steigerung der Produktion könnte man dadurch in absehbarer Zeit jedenfalls keinen Absatzraum schaffen. Die Zuckerrübe ist eine Kulturvarietät der
Runkelrübe (Beta vulgaris), die an den Küsten
des mittelländischen Meeres heimisch ist. Im Jahre
1747 hat der Chemiker Marggraf in Berlin
Rohzucker in der Runkelrübe nach 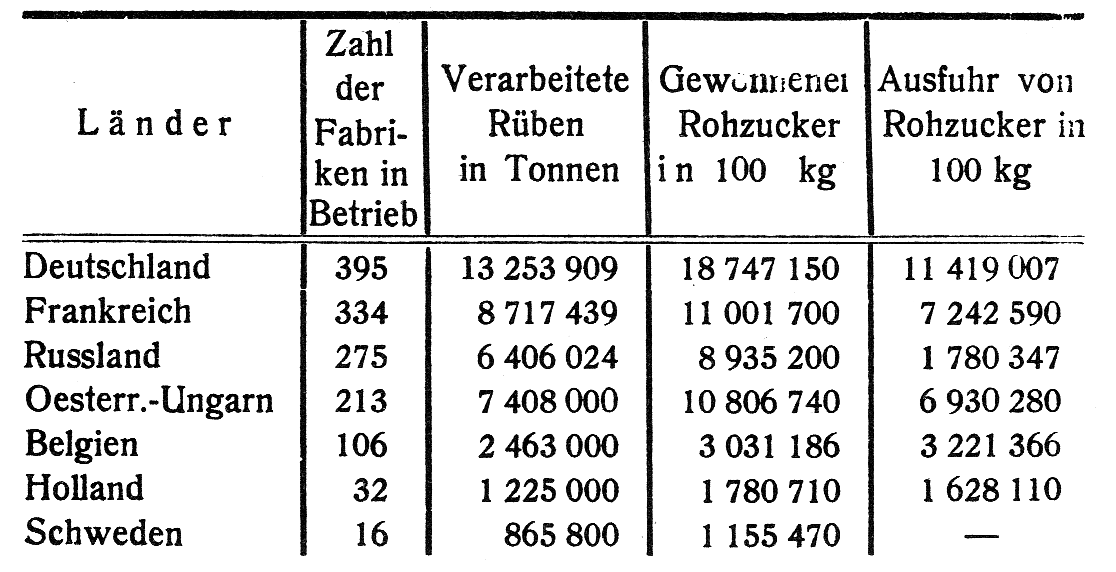
in Deutschland . . . . . . 23 000 000 Dz
" Oesterreich-Ungarn . . . . 13 060 000 "
" Frankreich . . . . . . 10 800 000 "
" Russland . . . . . . . 11 040 000 "
" Belgien . . . . . . . 3 250 000 "
" Holland . . . . . . . 2 040 000 "
" Schweden . . . . . . . 1 214 000 "
" Dänemark . . . . . . . 575 000 "
Andere europäische Länder . . . 2 000 000 "
Die europäische Rübenzucker-Industrie hat also bereits solchen Umfang angenommen, dass sie mehr als die Hälfte ihrer Produkte im Auslande absetzen muss. Hier begegnet ihr als Konkurrent die aussereuropäische Rohrzuckerproduktion, welche früher die grössere Hälfte Zucker für den internationalen Austausch lieferte, seit dem Jahre 1882/83 aber von der internationalen Rübenzuckerproduktion überflügelt worden ist. Es war nämlich die
Rohrzuckerproduktion die Rübenzuckerproduktion:
für den Weltmarkt:
in 100 kg in 100 kg
1871/72 18 689 930 10 513 500
1882/83 22 462 940 22 550 080
1896/97 28 786 000 48 211 920
1900/01 35 024 650 58 485 156
Schon aus diesen Ziffern geht hervor, dass die
Rübenzuckerproduktionsländer in den letzten
Jahren sich offenbar die schärfste Konkurrenz selbst
bereiten. Die Regierungen der einzelnen Länder
begünstigten und förderten ihre
Zuckerrüben-Industrie bisher auf verschiedene Weise,
besonders aber durch Gewährung mehr oder
minder
in Deutschland auf 2 M. 21 Pf.
" Oesterreich-Ungarn " 4 " 31 "
" Frankreich " 11 " 78 "
" Russland " 14 " 84 "
" Belgien " 3 " 71 "
" Schweden " 15 " 14 "
Die Höhe dieser Prämien, welche zu verschiedenen Zeiten verschieden waren, veranlassten im Zusammenhange mit dem Darniederliegen der anderen landwirtschaftlichen Produktionszweige einen Andrang zum Rübenanbau und eine Vergrösserung der Leistung der einzelnen Fabriken. Die durchschnittliche Verarbeitung an Rüben pro Fabrik in Deutschland betrug:
im Jahre 1836/37 . . . 2 077 Dz
" " 1870/71 . . . 100 681 "
" " 1897/98 . . . 341 004 "
" " 1900/01 . . . 335 542 "
Die Zahl der deutschen Zuckerfabriken ist im Jahre 1870/71 um 67, im Jahre 1884/85 um 32 gewachsen. Die anderen Länder Europas haben in dieser Entwickelung der Rübenzucker-Industrie kaum geringere Fortschritte gemacht. Das durchschnittlich verarbeitete Rübenquantum pro Fabrik war
im Jahre 1897/98 im Jahre 1900/01
in Deutschland 341 004 Dz 335 542 Dz
" Oesterreich-Ungarn 317 573 " 347 792 "
" Frankreich 184 920 " 261 001 "
" Russland 256 500 " 232 909 "
" Belgien 144 950 " 232 359 "
" Holland 295 424 " 382 812 "
" Schweden 448 137 " 541 125 "
1886/87 . . . . . 22,70 M.
1890/91 . . . . . 26,40 "
1895/96 . . . . . 21,80 "
1900/01 . . . . . 19,50 "
1901/02 . . . . . 13,70 "
Was aber diese Situation der
europäischen Rübenzuckerindustrie für die
Zukunft besonders bedenklich erscheinen lässt, das
ist der Umstand, dass das gewaltige Exportbedürfnis
für mehr als die Hälfte der Gesamtproduktion
bisher in der Hauptsache auf den Absatz in den
Vereinigten Staaten von Amerika und in
England angewiesen war und dass eben diese
beiden Länder auf dem besten Wege sind, ihren
Zuckerbedarf selbst zu produzieren. Es ist bekannt, dass
die Vereinigten Staaten früher eine jährliche
Zuckereinfuhr von über 18 Millonen Centnern hatten,
bevor sie unter dem Einflusse der nordamerikanischen
Zucker-Interessenten Hawai, Portorico und
die Philippinen sich einverleibten und ihren
gebieterischen Einfluss auch auf Cuba
ausdehnten. Alle diese Gebiete gehören gerade zu den
bedeutendsten Rohrzucker-Produktionsländern der
Erde, mit einer heute bereits auf über 25 Millionen
Centner gesteigerten durchschnittlichen Gesamtproduktion
an Rohrzucker. Die Rohrzuckergewinnung war früher in
ihrer Technik weit hinter modernen Anforderungen
zurückgeblieben. Die Energie und Erfindungs Dieser Entwickelung zur Grossindustrie wird nunmehr bald gänzlich der Exportabsatz genommen sein, und es ist daher gänzlich ausgeschlossen, dass in einer etwa noch weiteren künftigen Steigerung des Rübenbaues ein Ersatz für den Getreidebau gefunden werden könne. Die Resultate dieser historischen Betrachtung des Handelsgewächsbaues lassen sich in folgende Sätze zusammenfassen: Der Krappbau wurde ruiniert durch die synthetische Herstellung des Alizarins. Der Waidbau wurde ruiniert durch die Einfuhr der Indigopflanze, und die Indigopflanzen werden wohl demnächst ruiniert durch die synthetische Herstellung des Indigo.
Der Hopfenbau hat besonders durch stark steigende Einfuhr unter stets sinkender Ausfuhr und auch durch technische Fortschritte der verschiedendsten Art in der Bierbrauerei und Hopfenkonservierung seine frühere gute Rentabilität verloren. Der Tabakbau ist in Deutschland nur noch für jene Kleingrundbesitzer ratsam, bei denen alle Familienglieder zusammenarbeiten, denn auch hier erdrückt die Einfuhr die heimische Produktion. Der Rapsbau ist durch technische Erfindungen auf dem Gebiete des Beleuchtungswesens unrentabel geworden und wird, soweit Raps noch gebraucht wird, durch die Einfuhr ersetzt. Der Kartoffelbau zur Branntweinbereitung ist bereits bis zu einer Ausdehnung gelangt, die eine absolute Ueberproduktion darstellt, und es muss, wenn das Gewerbe halbwegs rentabel bleiben soll, nicht nur keine künftige Steigerung, sondern eine starke Beschränkung der Produktion herbeigeführt werden. Der Zuckerrübenbau geht insbesondere seit Abschluss der Brüsseler Konvention mit dem drohenden Ende der Zuckerausfuhr einer schweren Krisis entgegen. Hier ist also nirgends Raum für Einschränkung des Getreidebaues zu Gunsten des Handelsgewächsbaues. Gerade der Handelsgewächsbau erscheint vielmehr in allen seinen Teilen weit stärker bedroht, als der Getreidebau. All unsere nationalökonomischen Schulsysteme sind
bekanntlich aus dem praktisch-politischen Bedürfnis
ihrer Zeit hervorgegangen. Deshalb lässt sich das
Merkantilsystem als ein Finanzsystem, das physiokratische
als ein agrarpolitisches, das Adam Smith’sche
System als ein handelspolitisches System, der Marxismus
als ein System der Arbeiterpolitik bezeichnen. Wir haben
den vorausgeschickten entwickelungsgeschichtlichen
Betrachtungen entnommen, dass das uns heute fehlende neue
System der Nationalökonomie voraussichtlich
ebenfalls ein System der Arbeiterpolitik sein wird, das
indes nicht von dem viel zu engen Begriffe der
Lohnarbeit, sondern von dem Totalbegriff der
Arbeit im volkswirtschaftlichen Sinne ausgehen
wird. Der Schwerpunkt dieser Betrachtungen ruht also im
selbständigen Arbeiter, in der locatio conductio
operis, im selbständigen Mittelstande. Da
Schmoller in seiner „Geschichte der
deutschen Kleingewerbe im 19. Jahrhundert“ den
wichtigen Nachweis erbrachte, dass der gewerbliche
Mittelstand sich nur auf dem Rücken eines
wohlgesicherten Bauernstandes zu erhalten vermag,
rückt der Schwerpunkt dieser Art von Arbeiterpolitik
in seiner weiteren Betrachtung in die bäuerlichen
Verhältnisse ein. Diese Art von
Arbeiterpolitik gewinnt somit einen
agrarpolitischen Charakter. Damit ist
unzweifelhaft eine gewisse Analogie zu dem
physiokratischen System von Quesnay gegeben,
dessen Ausgangspunkt bekanntlich der Grund und
Boden war. Noch heute ist man ziemlich allgemein
der Anschauung, dass die Verhältnisse des
Grundbesitzes den eigentlichen Inhalt agrarpolitischer
Erwägungen ausmachen. Uns scheinen hier jedoch
folgende Bedenken beachtenswert. Nur die
landwirtschaftlich benutzte Bodenparzelle hat An Die Worte agrarisch und Agrarpolitik stammen von dem
lateinischen „ager“. Das gleiche Wort heisst
im indogermanischen „agros“, Feld, Acker, im
Sanskrit „ajras“, Feld, Acker, im
griechischen „agros“, im gothischen
„akrs“, althochdeutsch „ahhar“.
Das Wort „agros“ aber stammt von der Wurzel
„ag“, „treiben“ und bedeutet:
„wo das Vieh getrieben wird“ — also die
„Ackerfurche“, nicht aber die
„Trift“, wie Fieck, Kluge u. a.
angeben. Im hebräischen finden wir hierfür das
Wort „ichchar“ oder „ikar“ von
„achar“ „graben“,
„Ackersmann“, „Landmann“. Im
äthiopischen „agr“ als „ager
cultus“, im syrischen „akra“
„Landmann“, im arabischen
„achar“, graben, der „Graber“,
der „Landmann“. Also die hebräische,
äthiopische, syrische und arabische Sprache leiten
ihr Wort für „Acker“ von
„graben“ ab. Das ist die älteste Form
des Ackerbaus vor der Erfindung des Pfluges und dem
Anspannen des Rindes, der „Hackbau“, wie ihn
Eduard Hahn genannt hat, während
Sanskrit, lateinisch, griechisch und althochdeutsch das
Wort „Acker“ von der Pflugfurche ableiten, in
der das Vieh getrieben wird. Das Wort „ager“
bezieht sich also in der That nur auf den
landwirtschaftlich bearbeiteten Boden. Der Boden
hört auf mit dem Worte „ager“ in
Beziehung zu stehen, sobald er der landwirtschaftlichen
Kulturarbeit entrückt ist. Die Hacke und der Pflug
ziehen scharf die Grenze für *) Vergl. „Monatliche Nachrichten zur Regulierung der Getreidepreise“ Mai 1901, Wochenschrift „Getreidemarkt“ 9. April und 23. Juli 1902. Hermann Berg, „Getreidepreise und Kriminalität in Deutschland“ 1902 und die hier angegebene Litteratur. 1) Auf Seite 184/185 der Originalausgabe ist diese „Uebersichtskurve zu Seite 177“ abgedruckt. |
 |
 |
|
 |
||
| Impressum | Links | |